
Seit dem 1. Juli 2012 ist Josef Hecken unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Arzneimittel, Bedarfsplanung, Qualitätssicherung: nur einige Stichworte, die seine Arbeit prägen. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht Hecken über die künftigen Herausforderungen des G-BA, über Gestaltungsmöglichkeiten und Transparenz und über die Rolle der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen.
Herr Hecken, Ihre Vita liest sich eindrucksvoll. Landesgesundheitsminister, BVA-Präsident, Staatssekretär – was reizt Sie am G-BA-Vorsitz?
Der besondere Reiz meiner neuen Aufgabe liegt darin, dass sich hier jenseits der Theorie tatsächlich reale Versorgungspraxis gestalten lässt. Meine politischen Jahre waren eher von abstrakten Entscheidungen geprägt, während die Beschlüsse des G-BA unmittelbare Auswirkungen auf die Versorgungsqualität und das Leistungsgeschehen haben. Das ist für Patienten spürbarer als das, was an abstrakten Formulierungen in den Gesetzen steht. Das ist der erste Punkt.
Und der zweite Punkt?
Es ist die Kraft, die in der Selbstverwaltung steckt. Die Arbeit in der gemeinsamen Selbstverwaltung und die Entscheidungen, die wir hier trotz aller Konflikte zwischen den Bänken schließlich doch im Konsens selbst treffen, das ist echte Praxisnähe. Die gemeinsame Selbstverwaltung agiert damit in den meisten Fällen effektiver als eine abstrakte dritte Institution, fernab von Patienteninteressen. Das wirklich Erfüllende in der Arbeit im G-BA ist, dass jede einzelne Entscheidung unmittelbar auf die Versorgungspraxis einwirkt.
Als Institution ist der G-BA in den vergangenen Jahren gewachsen, die Politik überträgt ihm zunehmend mehr Aufgaben. Wird der G-BA künftig noch mehr an Stärke und Bedeutung gewinnen?
Ich denke ja, denn die Politik sieht, dass die gemeinsame Selbstverwaltung bewiesen hat, dass sie zur Konfliktlösung und praxisnahen Entscheidungsfindung imstande ist. Sie hat auch erkannt, dass es in vielen Fällen keine Alternative gibt. Wir treffen keine Entscheidung auf der Grundlage von Bauchgefühlen, sondern wir entscheiden auf der Basis von Evidenz. Und das sind Entscheidungen, die unmittelbar versorgungsrelevant sind und teilweise heftig kritisiert werden, weil es auf der einen Seite die optimale Patientenorientierung zu garantieren gilt, auf der anderen Seite jedoch auch wirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen sind. Und dies kann die Selbstverwaltung emotionsfreier und fachlich besser als die Politik. Daher ist sie auch klug beraten, diese Entscheidungen der Selbstverwaltung zu übertragen.
Ein Vertrauensvorschuss für die gemeinsame Selbstverwaltung?
Mit der zunehmenden Übertragung von Aufgaben ist ganz klar ein Vertrauensbeweis für die gemeinsame Selbstverwaltung verbunden, und dies freut mich sehr. Selbstverwaltung ist für mich ein konstitutives Wesenselement der Sozialversicherung. Sie ist eben keine staatliche Einrichtung, sondern eine, die von Versicherten und Arbeitgebern getragen wird und von den einzelnen Akteuren im Gesundheitswesen.
Dennoch gibt es auch seitens der Politik Kritik an der gemeinsamen Selbstverwaltung. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
Es ist im Leben ja häufig so, dass man über Dinge schimpft, die man selbst nicht besser machen kann. Dass die Politik manchmal darauf drängt, am besten noch bevor Dinge beschlossen sind schon Ergebnisse oder Umsetzungen zu sehen, ist legitim und Aufgabe von Politik. Sie weiß aber auch, dass es eine gewisse Zeit braucht, praxistaugliche Lösungen möglichst im Konsens zwischen den Bänken zu finden. In manchen Fällen wünscht sich die Politik, dass der G-BA etwas zügiger zu Entscheidungen kommt. So hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit häufig Fristen gesetzt, die gelegentlich nicht eingehalten werden konnten – einerseits aus nachvollziehbaren Gründen, andererseits aber auch, weil zu lange diskutiert wurde.
Ist es Ihr Anspruch, Entscheidungen schneller herbeizuführen?
Wir sollten uns anstrengen, solche Fristsetzungen dort, wo es möglich ist, auch einzuhalten – schon allein deshalb, um die Kraft und Bedeutung der Selbstverwaltung nicht zu schwächen. Ich möchte bei den Vertretern der Bänke dafür Verständnis wecken, dass wir in signifikant wichtigen Dingen Entscheidungen zügiger treffen, um unsere fachliche Autorität und unsere Reputation noch weiter zu stärken. Aber wie gesagt, ich glaube, trotz aller Kritik ist die Akzeptanz des G-BA bei der Politik hoch. Diese Akzeptanz können wir stärken, indem wir die hohe fachliche Qualität halten und die Entscheidungsfindung zügiger gestalten. So sind wir gut aufgestellt und beweisen, dass Selbstverwaltung besser ist als jedes andere Modell.
Die Patientenvertretung ist im G-BA derzeit so eingebunden, dass sie zwar kein Stimmrecht besitzt, aber bei allen Themen mitberät. Eine Lösung in Ihrem Sinne?
Ich halte die Einbeziehung der Patientenvertreter, so wie sie heute ausgestaltet ist, für außerordentlich hilfreich, weil sie die spezifische Patientensicht auf eine sehr verantwortungsbewusste Art und Weise in die Diskussion einbringt. Deshalb ist die Patientenvertretung eine wirkliche Bereicherung, und wir sind bestrebt, Entscheidungen immer im Einvernehmen mit der Patientenvertretung zu treffen. Die Patientenvertreter mit Stimmrecht auszustatten, hielte ich jedoch nicht für zielführend, schon alleine im Hinblick auf den Rechtsrahmen des G-BA, der eine gemeinsame Selbstverwaltung derjenigen Akteure ist, die als Finanziers oder Leistungserbringer im System eine aktive Rolle haben. Zudem würde es die Entscheidungsfindungen wesentlich komplizierter machen. Wie bereits mein geschätzter Vorgänger Dr. Rainer Hess frage ich vor jeder Abstimmung die Patientenvertretung, ob sie die Entscheidung mittragen. Das war in letzter Zeit überwiegend der Fall, insofern ist das Verfahren bewährt und gut.
Sie sind Vorsitzender der drei Unterausschüsse Arzneimittel, Bedarfsplanung und Veranlasste Leistungen. Sind es Felder, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Zum einen ist es so, dass jeder Unparteiische im G-BA einen der drei großen Unterausschüsse leitet: Arzneimittel, Qualitätssicherung und Methodenbewertung. Zum anderen muss man bei seiner Arbeit auch mit Leidenschaft dabei sein. Im Tagesgeschäft ist mir derzeit vor allem die Bedarfsplanung ein besonderes Anliegen, weil es ganz wichtig ist, flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Genauso ist der Arzneimittelbereich so etwas wie eine Herzensangelegenheit für mich.
Im Zuge der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a SGB V wird der G-BA mit mehr Verantwortlichkeiten konfrontiert. Wie meistern Sie diese?
Frühe Nutzenbewertungen von Arzneimitteln in den knappen Fristen erfordern ein absolut stringentes Projektmanagement, um alle Verfahren fachgerecht bearbeiten zu können. Dabei hat der Gesetzgeber zu Recht klare Fristen angesetzt, denn ein Unternehmen mit einem neuen Produkt am Markt hat einen Anspruch darauf, dass innerhalb einer angemessenen Frist entschieden wird, ob sein Medikament einen Mehrwert gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie hat und damit auch einen Anspruch auf Preisverhandlungen. Bislang wurden 25 Arzneimittel einer frühen Nutzenbewertung unterzogen, das Verfahren läuft inzwischen sehr gut, wir haben inzwischen auch diesen Anforderungen entsprechend unsere personellen Kapazitäten in der zuständigen Abteilung aufgestockt. Das anfängliche Grundmisstrauen der pharmazeutischen Industrie ist, so glaube ich, weitgehend abgebaut. Was natürlich Klagen nicht ausschließt.
Der G-BA darf sich jetzt bezüglich der Nutzenbewertung auch dem sogenannten Bestandsmarkt, also Arzneimitteln, die vor dem 1. Januar 2011 in den Verkehr gebracht worden sind, zuwenden. Welche Kriterien werden zugrunde gelegt?
Der Gesetzgeber hat das Kriterium „für die Versorgung von Bedeutung“ vorgegeben, das auch auf die Umsatzstärke abzielt. Ob das alleine trägt, weiß ich nicht. Ich persönlich halte es nicht für sachgerecht, zehn Blockbuster herauszupicken, die möglicherweise nur noch zwei Jahre Patentlaufzeit haben, während alle anderen erst einmal ungeprüft bleiben. Jedes Gericht würde hier die wettbewerbsrechtlichen Umstände prüfen und die Frage nach der Willkür stellen. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, belastbare, nachvollziehbare, vorhersehbare und rechtssichere Aufgreifkriterien zu entwickeln.
Wie könnten die aussehen?
Derzeit schwebt mir ein Modell vor, das nicht auf den aktuellen Umsatz abhebt, sondern auf die Patentlaufzeit eines Präparates und auf seinen tatsächlichen oder erwarteten Umsatz. Denn eine Momentaufnahme trifft einige wenige, eine perspektivische Vorgehensweise träfe alle gleich. Es geht um eine Langzeitbetrachtung. Aber dies muss noch sehr sorgfältig rechtlich geprüft und in den Gremien beraten werden, bevor wir einen Katalog mit Produkten und Laufzeiten erstellen können.
Wie lange würde das dauern?
Vorhin habe ich für Schnelligkeit plädiert. Hier aber sehen Sie mich als jemanden, der Schnelligkeit nicht um jeden Preis will, sondern lediglich bei den Themen und Sachverhalten, bei denen dies möglich und sinnvoll ist. Beim Thema Bestandsmarkt bringt es überhaupt nichts, gleichsam auf der Überholspur und im Ergebnis dann – ich formuliere es drastisch – frontal gegen die Wand zu fahren, in dem sicheren Wissen, dass der erste Prozess verloren wird. Deshalb gilt hier: Besser etwas mehr Zeit investieren, um über das Modell zu diskutieren und es vernünftig auszuarbeiten.
Kommen wir noch zum Thema Bedarfsplanung in der ambulanten Versorgung: Bis Ende des Jahres soll es eine neue Bedarfsplanungsrichtlinie geben. Was versprechen Sie sich davon?
Wir haben heute eine Unterversorgung in ganz bestimmten Regionen bei einer Überversorgung in anderen Regionen. Die neue Bedarfsplanungsrichtlinie bietet die Chance – in Ergänzung dessen, was der Gesetzgeber an Vergütungsanreizen geschaffen hat –, Arztsitze dort zu schaffen, wo multimorbide Menschen leben.
Zeichnet sich ein Kompromiss ab zwischen den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung?
Ich bin zuversichtlich, dass die gemeinsame Selbstverwaltung in den wesentlichen Punkten der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung einen Kompromiss findet. Es wäre auch schade, jetzt mit strittigen Abstimmungen der Öffentlichkeit kundzutun, dass man in einem so wesentlichen Themenfeld wie der Bedarfsplanung nicht in der Lage ist, zu einer einheitlichen Meinung zu finden. Es wird eine Reihe von Detailproblemen geben, aber momentan ist die Frage entscheidend, wie die Planungsregionen für die Grundversorgung aussehen. Die Krankenkassen präferieren die Planung auf der Mittelbereichsebene und die Versorgungssteuerung auf der Gemeindeebene, während die Ärzte auch die Planung auf der Gemeindeebene wünschen. Vom Interesse her sind beide Bänke relativ nah beieinander. Beide wollen, dass Versorgung dorthin gelangt, wo Versorgung benötigt wird, und nicht nur dorthin, wo es schön ist.
Und wie sieht es mit dem Abbau von Überversorgung aus – auch in der zeitlichen Perspektive?
Das wird auf einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren hinauslaufen. Für eine gewisse Übergangszeit wird es insbesondere im Bereich der Grundversorgung einen Mehrbedarf an Ärzten in strukturschwachen Regionen geben, dem eine Überversorgung in Ballungszentren gegenübersteht. Denn wir können Praxissitze im Prinzip nur dann abbauen, wenn eine Ärztin oder ein Arzt aus Altergründen ausscheidet. Mittelfristig muss dem Aufbau von Strukturen in ländlichen Regionen eine Reduktion in überversorgten Gebieten gegenüberstehen. Notwendig bei der Planung ist ein Indikator, der von Morbidität anstatt ausschließlich von Demografie abgeleitet ist. Nicht der allein alte Mensch hat einen erhöhten Versorgungsbedarf, sondern der morbide alte Mensch ist es, um dessen umfassende und gute medizinische Versorgung es geht.
Wie viele neue Arztsitze entstehen denn dann unter dem Strich?
Über diese Frage wird gerade diskutiert. Es ist klar, dass alle Seiten zunächst mit Maximalvorstellungen in die Verhandlungen gehen. Deshalb können wir noch keine genauen Zahlen nennen. Klar ist aber bereits jetzt, dass es mehr Arztsitze als bisher geben wird.
Wo gibt es noch Detailprobleme zu klären?
Beispielsweise bei der Psychotherapie. Ich glaube nicht, dass wir für den großen Bereich der Psychotherapie bis zum 31. Dezember valide Daten bekommen. Der Gesetzgeber wird dem G-BA voraussichtlich nach der Sommerpause den Auftrag erteilen, die Versorgungsstruktur bei der Psychotherapie zu untersuchen. Deshalb wäre es unsinnig, bereits jetzt für diesen Bereich etwas zu beschließen, weil wir wegen fehlender Daten gar nicht genau wissen, wie sich das Versorgungsgeschehen in der Fläche darstellt.
Sie haben eine sechsjährige Amtszeit vor sich. Setzen Sie sich ganz besondere Ziele?
Jenseits einzelner Themen ist mir ganz wichtig, dass wir in unseren Entscheidungen und Begründungen transparent sind. Patienten sind keine Kunden in einem Gesundheitsmarkt, wie vielfach deklariert. Sie brauchen vielmehr Vertrauen in eine Instanz, von der sie wissen, dass deren Entscheidungen der Maxime einer qualitätsgesicherten Versorgung folgen und nicht vorrangig finanzpolitischen Interessen. Dieses Vertrauen ist in einer zunehmend komplexer werdenden Versorgungslandschaft wichtig – und dabei kann der G-BA wirklich eine bedeutende Rolle spielen.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 9./10.2012
-
 Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz
Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzKrebsfrüherkennungs- und -registergesetz: Ineffiziente Strukturen auflösen



 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit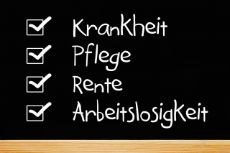 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


