
Baden-Württemberg hat kürzlich federführend eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, um das Vergütungssystem im Krankenhausbereich zu reformieren. Etwa zeitgleich stellte das Bundesgesundheitsministerium den Kliniken eine Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro zusätzlich in Aussicht. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht Baden-Württembergs Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) über die Probleme und Herausforderungen in der Krankenhauslandschaft, über Steuerungsmechanismen und eine Versorgungslandschaft der Zukunft.
Frau Ministerin Altpeter, von Haus aus sind Sie Altenpflegerin. Rührt daher Ihr Interesse an der Gesundheitspolitik?
Man muss vielleicht noch weiter zurückgehen. Schon als Jugendliche habe ich mich jugendpolitisch engagiert, ich komme ursprünglich aus der Jugendzentrumsbewegung. Mir war schnell klar, dass ich einen sozialen Beruf erlernen möchte, und hauptamtlich wollte ich dann gerne mit älteren Leuten arbeiten. Und daneben gab es schon immer ein politisches Interesse. Heute kann ich von meiner praktischen Erfahrung sehr profitieren, insbesondere bei allen Fragen rund um Pflege.
Die Krankenhäuser stehen derzeit im Fokus der politischen und öffentlichen Debatte. Die schwarz-gelbe Koalition hat sich auf ein Förderprogramm verständigt, die Kliniken erhalten eine Milliarde Euro mehr. Wie stehen Sie dazu?
Es ist gut, dass vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums überhaupt erkannt wird, dass etwas getan werden muss. Dies will ich durchaus anerkennen. Allerdings verteilt sich die Entlastung von 1,1 Milliarden Euro auf zwei Jahre und auf bundesweit rund 2.000 Krankenhäuser bzw. rund 500.000 aufgestellte Betten. Zudem löst das Geld, das jetzt mit dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet wird, nicht die Probleme der Krankenhäuser. Man muss schon sehr genau hinsehen, wo welche Krankenhäuser rote Zahlen schreiben und wo wie viel für den Bedarf nötig ist. Das scheint mir in dem Fall des Geschenks von Daniel Bahr nicht unbedingt der Fall gewesen zu sein. So werden die grundsätzlichen Finanzierungsprobleme der Krankenhäuser nicht gelöst.
Nach welchen Kriterien würden Sie das Geld verteilen?
Im Zuge der Bundesratsinitiative, die wir zur Verbesserung der Finanzierung der Kliniken gestartet haben, schlagen wir zum Beispiel die Erhöhung des Landesbasisfallwerts um ein Prozent vor, als Ausgleich für steigende Personal- und Energiekosten. Darüber hinaus bin ich der Auffassung, dass man sehr genau auf die Frage der Mengenausweitung schauen muss. Es kann nicht sein, dass das eine Krankenhaus finanziell leidet, wenn das andere die Mengen ausweitet. Dies ist jetzt zwar nicht Inhalt der Bundesratsinitiative, aber wir müssen auch darauf achten, wie kleinere Krankenhäuser vorwiegend der Grundversorgung in ländlichen Gebieten gestärkt werden können. Diese Häuser haben zwangsläufig ganz andere Kostenstrukturen als große Krankenhäuser in Ballungsgebieten.
Führt denn die Erhöhung des Landesbasisfallwerts, die dann flächendeckend für alle Krankenhäuser gilt, nicht auch zu einem Gießkannenproblem?
Wir können über alle Bundesländer hinweg feststellen, dass derzeit nahezu alle Krankenhäuser große Probleme haben in der grundsätzlichen Betriebskostenfinanzierung. Da könnte eine Landesbasisfallwerterhöhung um ein Prozent die ärgste Not lindern und wäre eine schnelle Hilfe. Die grundsätzliche Weiterentwicklung des Vergütungssystems wird in dieser Legislaturperiode von der Bundesregierung nicht mehr angegangen werden.
Die Einführung der diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG) bzw. Fallpauschalen hat das Kliniksystem weiterentwickelt. Wo sehen Sie hier Änderungsbedarf?
Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die Fallpauschalen zu Verbesserungen geführt haben. Sie führten natürlich auch dazu, dass die Verweildauer in den Krankenhäusern kürzer geworden ist und effektiver gearbeitet werden kann. Dennoch, und sagen wir mal so: Schwere Krankheit bringt viel Geld und umfangreiche Behandlung. Wir sind aber eine Gesellschaft der älteren Menschen, in der nicht unbedingt immer die schwere Krankheit im Vordergrund steht, sondern Behandlungen der Grundversorgung, die im Krankenhaus anfallen. An dieser Stelle ist es überprüfungs- und überdenkenswert, ob die Fallpauschale diese Kostenstrukturen richtig abbildet. Das Gleiche gilt im Hinblick auf die Behandlung von schweren Erkrankungen bei Kindern sowie psychiatrischen Erkrankungen.
Sie haben die Mengenausweitung angesprochen. Dieses Problem thematisiert auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht. Wie lässt sich die Mengenentwicklung besser in den Griff kriegen?
In Baden-Württemberg ist das Problem der Mengenausweitung zwar nicht so virulent wie in anderen Bundesländern, aber grundsätzlich muss hier gegengesteuert werden. Letztlich sind für das Problem der Mengenausweitung Fehlanreize im derzeitigen Finanzierungssystem verantwortlich.
Der Verband der Ersatzkassen schlägt vor, dass Kliniken, die sich nicht an entsprechende Qualitätsindikatoren halten, Abschläge zahlen müssen. Was halten Sie davon?
Das könnte durchaus eine Möglichkeit sein, wenn man sich zuvor gemeinsam auf Qualitätsindikatoren geeinigt hat und die Einhaltung dann auch als Verpflichtung begreift. Entsprechend muss dann eine Nichteinhaltung mit Sanktionen belegt werden, was ich durchaus für richtig und konsequent halte. Und die Datenmenge, um Qualitätskriterien zu entwickeln, ist vorhanden.
Liegen die Finanzierungsprobleme der Krankenhäuser nicht auch darin, dass die Länder ihrer Verpflichtung zur Finanzierung der Investitionskosten ‒ wie bauliche Maßnahmen ‒ nicht nachkommen? So spricht die Deutsche Krankenhausgesellschaft von einem Investitionsstau von rund 50 Milliarden Euro insgesamt. Stehlen sich die Länder aus der Verantwortung?
Da muss ich ganz klar sagen, dass wir in Baden- Württemberg zu unserer Verantwortung stehen, die mit der Finanzierung auch die Steuerung und Planung der Krankenhausstruktur umfasst. Das nehmen wir sehr ernst. Wir haben nicht nur das Investitionsvolumen für die Einzelförderung erhöht, sondern auch die pauschale Förderung für die Krankenhäuser um noch mal zehn Millionen Euro. Wobei es natürlich noch gut und gerne mehr hätte sein können. Insgesamt aber liegt die Förderung von Krankenhausinvestitionen für dieses und nächstes Jahr in Baden-Württemberg zusammen bei 795 Millionen Euro, was eine Menge ist.
Wurde in der Vergangenheit zu viel versäumt?
Bei Regierungsübernahme haben wir im Krankenhausbereich einen Antragsstau von fast 1,3 Milliarden Euro vorgefunden. Deswegen war es uns auch wichtig, im Koalitionsvertrag den Abbau des Antragsstaus festzulegen. Natürlich hätte man in der Vergangenheit steuernder eingreifen und für Investitionen mehr Geld zur Verfügung stellen müssen. Nun sind wir damit beschäftigt, zum einen den Antragsstau abzubauen, zum anderen die Krankenhauslandschaft insgesamt zu strukturieren. Denn nicht nur die Investitionskosten sind ein Problem: Jedes zweite Krankenhaus im Land schreibt inzwischen rote Zahlen.
Stichwort Krankenhausplanung: Auch hier wünschen sich die Krankenkassen mehr Mitspracherecht. Allerdings dürfen sie derzeit zwar bei der Planung von Betten mitreden, aber nicht mitentscheiden. Jedes Krankenhaus – ob gut oder schlecht ‒ bekommt einen Versorgungsvertrag. Können Sie sich eine Änderung vorstellen, zum Beispiel dergestalt, dass Betten reduziert bzw. Abteilungen geschlossen werden, wenn bestimmte Qualitätskriterien nicht eingehalten werden?
Die Einflussnahme geschieht bei uns bereits. Im Landeskrankenhausausschuss erlebe ich es immer wieder, dass ¬ wenn Krankenhausträger eine Ausweitung der Betten beantragen – auf Vorschlag der Krankenkassen erst der Medizinische Dienst der Krankenversicherung beauftragt wird, zu dem Antrag Stellung zu nehmen und die Qualitätskriterien in den Häusern zu messen. Sind diese nicht erfüllt oder genügen nicht den Ansprüchen, dann sind die Krankenhausträger gehalten nachzubessern. Aus vielerlei Gründen sollten jedoch die Länder die Planungshoheit unbedingt behalten.
Wie sieht die Situation konkret in Baden-Württemberg aus?
Die Krankenhaushäufigkeit ist in Baden-Württemberg im Vergleich zu allen anderen Bundesländern am niedrigsten; das heißt bei uns fallen die wenigsten Aufenthaltstage in Krankenhäusern an. Das zeigt, dass wir insgesamt ein gut entwickeltes, abgestuftes Versorgungssystem haben. Baden-Württemberg hat im Vergleich zu anderen Bundesländern in den letzten Jahren zudem schon erhebliche Bettenkapazitäten abgebaut, das heißt auch hier sind wir bereits gut aufgestellt. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir krankenhausplanerisch keine Probleme hätten. So haben wir einige, wenn auch nicht viele, sehr kleine Kliniken mit erheblichen strukturellen Problemen. Eine solche stationäre Versorgung ist weder wirtschaftlich noch aus Qualitätsaspekten zu halten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir das Krankenhaus schließen müssen. Vielmehr könnte sich an diesem Standort etwa ein Gesundheitszentrum entwickeln. Damit könnten sich auch andere Strukturprobleme, zum Beispiel hausärztliche Versorgung im ländlichen Bereich, besser lösen lassen. Daneben sind natürlich noch andere Maßnahmen vorgesehen, beispielsweise die Zulassung von Praxen, in denen mehrere Ärzte angestellt sind. Oder auch durch unser Förderprogramm Landärzte, im Zuge dessen der Arzt für eine Niederlassung in einem als strukturschwach identifizierten Gebiet 30.000 Euro Zuschuss beantragen kann. Es müssen Anreize geschaffen werden.
Da sprechen Sie die Verzahnung von ambulantem und stationärem Sektor an.
Das GKV-Versorgungsstrukturgesetz gibt uns generell die Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit des stationären und ambulanten Sektors. Wir haben deshalb als erstes Bundesland einen sektorenübergreifenden Beirat gegründet, um mit Vertretern aus ambulant und stationär sowie der Kommunen zu erörtern, wie man die Probleme gemeinsam angehen kann, insbesondere was die Verzahnung ambulant und stationär betrifft. Ein Beispiel der Verzahnung sind die Notfallpraxen, die künftig in fast allen Fällen an ein Krankenhaus angesiedelt werden.
Macht es – auch aus Qualitätsgesichtspunkten – Sinn, sich in ländlichen Regionen auf Krankenhäuser der Grundversorgung zu beschränken und schwierige Behandlungen auf spezialisierte Kliniken in weiterer Entfernung zu konzentrieren?
Das macht aus unserer Sicht viel Sinn, denn wirklich komplizierte Fälle erfordern auch eine spezialisierte Versorgung und diese muss aus unserer Sicht konzentriert sein. Der Erfahrung nach nehmen Patienten für gute Qualität bei spezialisierten Dingen auch weitere Wege in Kauf. Dennoch muss auf der anderen Seite eine flächendeckende Grundversorgung gewährleistet sein.
Immer wieder wird kritisiert, dass in Deutschland zu viel und unnötig operiert wird. Die Versicherten wird dies extrem verunsichern. Was kann denn ein Patient tun, um das zu vermeiden?
Ich glaube, das Bewusstsein, als Patient aufmerksam und kritisch zu sein, wächst langsam, nicht zuletzt deshalb, weil man heute als Patient über viel mehr Informationsquellen verfügt. Patienten haben heute ein verstärktes Informations- und Transparenzbedürfnis, dem muss das Gesundheitswesen entgegenkommen. Wir haben uns deshalb entschlossen, einen Gesundheitsatlas Baden-Württemberg zu erstellen, der dem Patienten genau Auskunft gibt, welches Angebot an welcher Stelle vorhanden ist. Der Gesundheitsatlas ist ein Online- Angebot des Landesgesundheitsamtes, bei dem man wichtige Daten abrufen kann, wie etwa zum Auftreten von Krankheiten, zur Säuglingssterblichkeit, zur Ärztedichte oder zur Lebenserwartung.
Trotzdem hat der Patient oft den Eindruck, er sei den Klinikärzten relativ hilflos ausgeliefert.
Deshalb ist das Prinzip der zweiten Meinung umso wichtiger. Dass dies jetzt auch ermöglicht und durch die Kasse finanziert wird, finde ich sehr wichtig. Der Arzt sollte den Patienten auf diese Möglichkeit auch unbedingt aufmerksam machen.
Schauen Sie noch einmal zurück: Haben Sie nach der Landtagswahl vor gut zwei Jahren als grün-rote Landesregierung neue Akzente gesetzt?
Ich muss es generalisieren, sonst müsste ich zu viele Einzelprojekte nennen. Insgesamt glaube ich, dass es uns als grün-rote Landesregierung gelungen ist, ein anderes Klima zu schaffen. Ein Klima, in dem die Menschen ernst genommen werden, und zwar in allen Politikbereichen. Wenn ich zum Beispiel Maßnahmen in der Gesundheitspolitik Baden-Württemberg ergreife, dann wird es im Gegensatz zu früher mit Beteiligung der Bürger und Betroffenen angegangen. Ich denke, das ist der wesentliche Aspekt, neben all den Inhalten, die wir bereits vorangetrieben haben.
Wie sieht Ihre idealtypische Versorgungslandschaft in 20 Jahren aus?
Ich stelle sie mir so vor, dass wir spezialisierte Angebote konzentriert vorhalten, sodass sie zwar für die Menschen noch erreichbar sind, aber wirklich konzentriert an wenigen Standorten. Daneben haben wir ein System der Grundversorgung wohnortnah und flächendeckend, in dem es eine sehr enge Zusammenarbeit und Kooperation gibt zwischen stationärer und ambulanter Versorgung und Angebot. Die Rolle und das Selbstverständnis der Patientinnen und Patienten werden sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Sie werden zunehmend besser informiert sein und so zu kritischen Partnern und Begleitern der medizinischen Versorgung werden.





 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit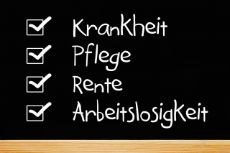 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


