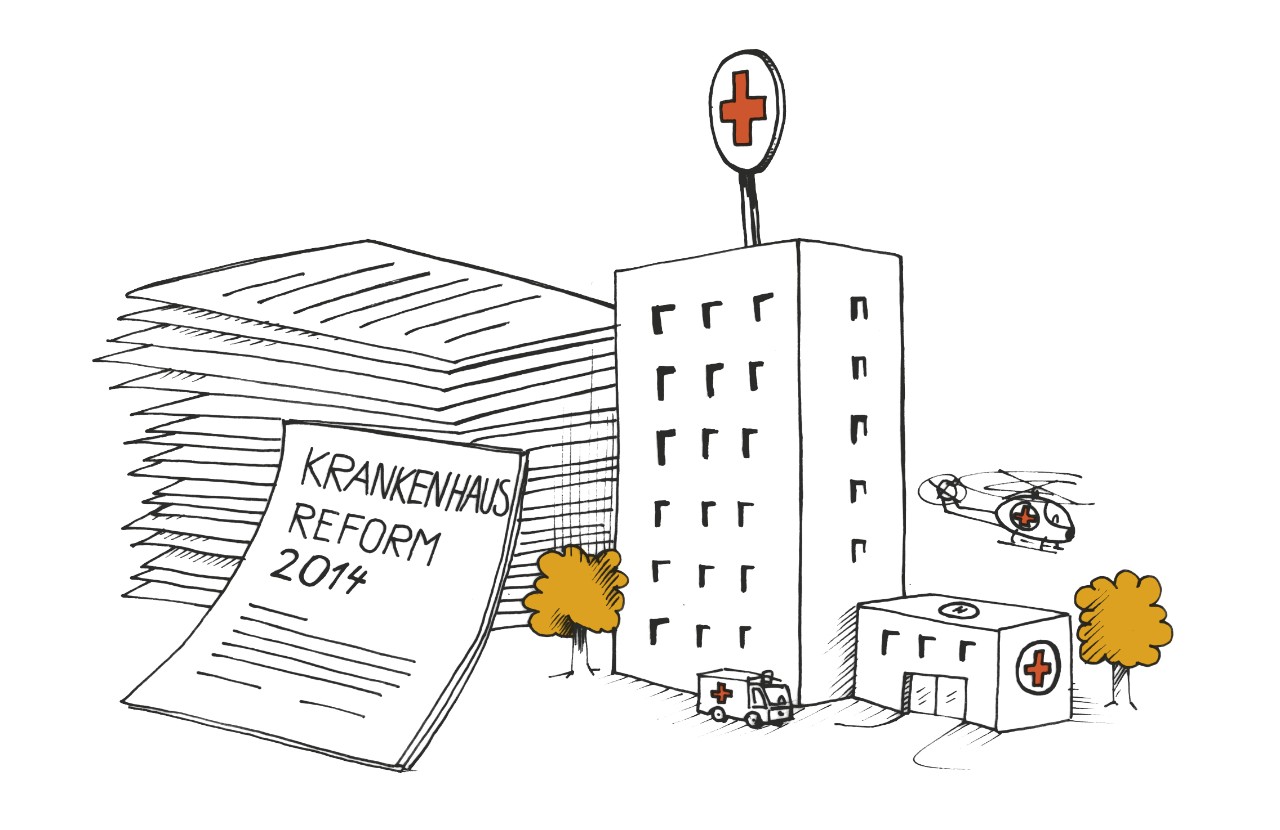
Bereits vor der Bundestagswahl sind sich die Parteien einig gewesen, dass der Krankenhausbereich einer Reform bedarf. Vor allem die Mengenentwicklung und das Investitionsfinanzierungsdebakel der Bundesländer machen eine Neugestaltung notwendig. Zudem ist eine breit angelegte Qualitätsorientierung dringend geboten, des Weiteren sind die Schnittstellen zur ambulanten Behandlung neu zu justieren. Dabei ist spannend, ob es zum Einsatz weiterer Wettbewerbsinstrumente kommt oder auf probate, wenn auch zu modifizierende Mittel wie Budgetierung und Planung zurückgegriffen wird.
Generell gilt: Die diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG) sind ein Instrument, kein System. Als Instrument sind die deutschen DRG international anerkannt und erfolgreich. Weltweit dienen DRG nicht nur der Verbesserung der Transparenz und Verteilungsgerechtigkeit, sondern werden vor allem als Budgetierungsinstrument eingesetzt. Nur Deutschland bildet eine Ausnahme. Die Leistungserbringer hatten es seinerzeit verstanden, mit der DRG-Einführung die Forderung zu verbinden, dass das Geld der Leistung folgt. Dem folgte der Gesetzgeber blindlings.
Die Ökonomisierung des Krankenhaussektors begann mit der Einführung eines landesweiten Festpreissystems. Festpreise steuern keine Mengen. Der Butterberg aus den 80er Jahren ist ein Beweis hierfür. Daraus erklärt sich der Mengenanstieg, wenngleich auch Morbidität und Demografie eine Rolle spielen. Die DRG-Begleitforschung hat das Verhältnis von erklärbarem und unerklärbarem Mengenanstieg aufgegriffen. Ein Forschungsauftrag soll hierzu Klarheit im Frühsommer 2014 geben. Der Mengenanstieg konnte auch deshalb realisiert werden, weil die Länder Kapazitäten und Standorte im Rahmen der Krankenhausplanung einfach fortschrieben. Auf die Marktentwicklung gingen sie nicht ein. Über das Leistungsspektrum eines Krankenhauses entschied der Träger unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nahezu ungeachtet übergeordneter Kriterien der Bedarfsgerechtigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität. Eine sachgerechte Spezialisierung und eine koordinierte Bildung von Zentren und Schwerpunkten fanden nicht statt. Ambulante und stationäre Kapazitäten blieben beziehungslos.
Statistisch gesehen verringerte sich die Zahl der Krankenhäuser deutlich, faktisch ist dies auf Fusionen zurückzuführen. Die Kapazitäten sind heute die gleichen wie vor der DRG-Einführung. Dabei veränderte sich die Struktur der Trägerschaften, private Träger nahmen zu. Die Krankenhäuser senkten ihre Kosten, erhöhten stark ihre Mengen in den Ballungsgebieten und erwirtschafteten Gewinne. Zugleich stiegen die Ausgaben der Krankenkassen deutlich, insbesondere wegen des Mengenanstiegs. Im Zuge des Festpreissystems konnten sie nicht über Grenzkosten oder Gewinne verhandeln.
Qualität stärker gewichten
Zudem ist der Mengenanstieg nicht nur ökonomisch bedenklich, sondern auch medizinisch. Die Leistungsausweitung fand gerade in den operativen Fächern mit planbaren Operationen statt. Jede medizinisch nicht notwendige Operation oder Leistung ist juristisch bedenklich. Dabei ist und bleibt das Problem die Beweislast. Die Rechte der Krankenkassen bei der Abrechnungsprüfung wurden durch eine Aufwandspauschale von 300 Euro sogar noch erschwert. Der Qualitätsreport des AQUA-Instituts belegt, dass die Qualität zwar im bundesweiten Durchschnitt gut ist, es aber gravierende Unterschiede innerhalb der Kliniklandschaft gibt. Einige Krankenhäuser erbringen nachweislich und ungehindert schlechte Qualität. Das DRG-System unterscheidet nicht zwischen guter und schlechter Qualität – auch in Bezug auf die Indikationsstellung. Die Länderplanung im Übrigen auch nicht.
Ziel muss sein, im Sinne einer Patientenorientierung eine flächendeckende Versorgung mit bestmöglicher Qualität sicherzustellen. In ländlichen Regionen stehen flächendeckende Versorgung und gute Qualität zum Teil im Widerspruch. Menge und Qualität korrelieren bis zu einer Grenze positiv; darauf gründen die Mindestmengenregelungen. Diesen Widerspruch gilt es im Sinne von Kompromisslösungen zu entschärfen.
In urbanen Gebieten sieht es anders aus. Eine Zentralisierung von Leistungsschwerpunkten erhöht die Versorgungsqualität, ohne dass eine flächendeckende Versorgung nennenswert in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Planungsbehörden müssen sich dieser Tatsache stellen und dieses Feld nicht einseitig den Krankenhausträgern überlassen. Die Krankenkassen müssen gemeinsam mit den Krankenhausträgern die Versorgungsaufträge konkretisieren können. Insgesamt müssten die Länder verpflichtet werden, bei der Planung das Kriterium der „Qualität“ anzuwenden. Hierfür müsste der Gemeinsame Bundesausschuss gesetzlich verpflichtet werden, planungstaugliche Qualitätskriterien zu entwickeln. Krankenhäuser, die nachweislich dauerhaft eine schlechte Qualität erbringen, müssen entweder von der Planungsbehörde oder im Zuge von Budgetvereinbarungen von der Versorgung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Um eine unter Qualitätsgesichtspunkten längst überfällige Spezialisierung voranzutreiben, sollten die Ländern neben ihrer obligatorischen Rahmenplanung eine Spezialplanung durchführen, in der Zentren und Schwerpunkte ausgewiesen werden, um deren inflationären, monetär getriebenen Entwicklung zu begegnen.
Innovationen ja, aber nicht überall
Auch die Einführung von Innovationen beinhaltet Risiken für den Patienten. Nicht jede Produktänderung bringt einen medizinischen Vorteil, wenngleich sie die lukrative Abrechnung eines hausindividuellen Entgelts unter der Rubrik „Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ ermöglicht. Innovationen und medizinischer Fortschritt sind nicht dasselbe. Medizinischer Fortschritt soll den Patienten nicht vorenthalten werden. Ob eine neue Behandlungsmethode oder Produktänderung eine medizinische Verbesserung darstellt, muss nachgewiesen werden. Daher sollten nur Innovationszentren, insbesondere Universitätsklinken, neue Verfahren erbringen dürfen. Diese müssen im Rahmen einer wissenschaftlichen Evaluation ermitteln, ob die Methode oder das Verfahren auch einen tatsächlichen Nutzen für den Patienten mit sich bringt. Erst wenn dieser nachgewiesen worden ist, sollte die neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode für weitere Krankenhäuser freigegeben werden. Die Länder sollten daher im Rahmen einer Spezialplanung auch Innovationszentren ausweisen.
Auch in der stationären Versorgung hat gute Qualität ihren Preis; schlechte Qualität jedoch einen noch höheren. Jede unnötige Operation ist unwirtschaftlich, jede Wiederbehandlung aufgrund mangelnder Qualität erhöht die Ausgaben. Das DRG-System honoriert sogar noch Komplikationen und Wiederaufnahmen. Es differenziert nicht nach deren Ursachen, weil Diagnose und Operationsschlüssel dies nicht immer zulassen. Das liegt an der Verweigerungshaltung der Leistungserbringer, die Schlüssel sinnvoll zu ergänzen. D en Krankenkassen muss es wieder möglich sein, mit den Krankenhausträgern Leistungsspektren im Rahmen von Budgets zu vereinbaren. Nicht jede DRG-Leistung muss im Rahmen einer Generalvollmacht von allen Krankenhäusern erbracht werden können. Versorgungssteuerung ist keine unternehmerische Entscheidung, sondern bedarf einer übergeordneten Betrachtung. Länder, Krankenkassen und Krankenhausträger müssen hier neue Wege gehen. Die Festlegung des Leistungsspektrums eines Krankenhauses führt zu einem Budget. Eine flexible Budgetierung ist nichts Rationierendes. Viel mehr ermöglicht sie es, die Vorhaltung von Leistungen auch als Leistung zu werten. Mehr- oder Mindererlösausgleiche stellen die vereinbarte Gesamtleistung eines Krankenhauses in den Vordergrund. Das heutige Einzelfestpreissystem honoriert Mengen, unabhängig davon ob sie gut oder schlecht beziehungsweise gewollt oder ungewollt sind. Eine hausindividuelle Preisdifferenzierung ist kein Widerspruch zum DRG-System. Abweichungen zum Festpreis sollten möglich sein, beispielsweise auch um den Aspekt der Kostendegression bei Mengenausweitungen aufzugreifen.
Verzahnung oder Öffnung der Krankenhäuser?
Kurze Verweildauern, neue medizinische Behandlungsmethoden und Therapieverfahren führen dazu, dass die Grenze zwischen stationärer und ambulanter Versorgung immer kleiner wird. Die Zahl der stationären Tagesfälle nimmt deutlich zu. Dennoch bleiben die sektoralen Strukturen bestehen. Sektorenübergreifende Kooperationen bleiben immer noch die Ausnahme. Seit 1988 ist der Gesetzgeber bestrebt, dieses Thema aufzugreifen. Dabei ist unklar, ob es ihm um eine bessere Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors oder um eine Öffnung der Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung geht. Auch deshalb weist das DRG-System immer noch nur fünf teilstationäre DRG auf. Über die Wahl des Behandlungssektors entscheidet die Abrechnungsmöglichkeit. Der neu geschaffene Sektor der spezialfachärztlichen Versorgung soll gleiche Voraussetzungen für die Sektoren schaffen. Dies ist gelungen; jeder der kann, darf Leistungen erbringen. Eine Verbesserung der Versorgung kann mit dieser Form der Liberalisierung nicht erwartet werden; jedoch sind steigende Leistungszahlen ohne Qualitätsnachweis wahrscheinlich.
In unterversorgten ländlichen Gebieten wird es künftig darum gehen, die Sektorengrenzen zu durchbrechen. Gerade hier erstreckt sich der Versorgungsmangel häufig auf beide Bereiche. In diesen Regionen müssen Krankenhäuser als Gesundheitszentren zur ambulanten und stationären Versorgung umgewidmet werden. Es gilt, die Sicherstellung der Versorgung sektorenübergreifend zu regeln.
Patienten in den Fokus rücken
Im internationalen Vergleich gesehen, besitzen wir hierzulande ein hervorragendes DRG-System und ausbaufähige Qualitätssicherungsverfahren, die mit einer guten Dokumentationskultur einhergehen. Diese Instrumente gilt es, künftig adäquat zu nutzen. Dies muss Gegenstand der nächsten Krankenhausreform sein. Medizinische und demografische Veränderungen sowie ökonomisches Fehlverhalten müssen thematisiert werden. Qualität und Wirtschaftlichkeit stehen nicht zwangsläufig im Zielkonflikt. Es bedarf gesetzlicher Rahmenbedingungen, die den Patienten in den Vordergrund stellen und eine Versorgung mit hoher Qualität garantieren. Einzelwirtschaftliche Interessen dürfen nicht die Strukturen bestimmen. Wettbewerbsideen, wie Ausschreibungsmodelle, die den Preis und nicht die Qualität in den Vordergrund stellen, sind daher ungeeignet. Der Trend muss wieder zur Daseinsvorsorge zurückkehren.





 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit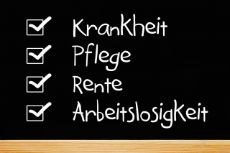 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


