
Der Arzneimittelbereich ist der zweitgrößte Ausgabenblock der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 2014 rechnet man mit Ausgaben von 31 Milliarden Euro, einer Steigerung zum Vorjahr von zwei Milliarden Euro. Was muss getan werden, um die Ausgabenentwicklung zu stoppen? Und sind die Weichen in der Arzneimittelversorgung richtig gestellt?
Arzneimittelexperte Prof. Dr. Gerd Glaeske sieht im Gespräch mit ersatzkasse magazin. die aktuellen politischen Vorhaben im Arzneimittelbereich kritisch. Er fordert einen stärkeren Fokus auf Qualität und Evidenz.
Herr Prof. Dr. Glaeske, die CDU und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen auf die Verlängerung des Preismoratoriums und einen Herstellerrabatt von sieben Prozent geeinigt. Im Gegenzug soll auf den Bestandsmarktaufruf für patentgeschützte Arzneimittel verzichtet werden. Was halten Sie davon?
Prof. Dr. Gerd Glaeske Ich kann es wirklich nicht anders sagen, aber ich bin ziemlich entsetzt über die Regelungen. Was mich am meisten bestürzt ist, den Bestandsmarkt aus dem AMNOG herauszunehmen. Wir haben sehr auf die Bestandsmarktbewertung gesetzt und es gibt nach wie vor viele Präparate, die vor dem AMNOG, also vor dem 1. Januar 2011 auf dem Markt waren. Hier schätze ich das Einsparvolumen wirklich auf zwei bis drei Milliarden Euro derzeit. Besonders wichtig ist hier, dass die Evidenz vieler Präparate, auch von denen, die unter den Top 20 stehen, fehlt. Diese Evidenz, die schon 2004 mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) und dann insbesondere mit dem AMNOG Einzug erhalten hat, geht jetzt spurlos am Bestandsmarkt vorbei. Man lässt sich hier und in Zukunft die große Chance entgehen, den Bestandsmarkt, den ich zum Teil noch relativ lange habe, unter Qualitäts- und Kostenaspekten zu prüfen.
Können Herstellerrabatt und Preismoratorium diesen Wegfall kompensieren?
Als ich hörte, man wolle die Bestandsmarktprüfung fallen lassen, hoffte ich, dass man dann wenigstens den Herstellerrabatt von derzeit 16 Prozent aufrechterhält. Diese 16 Prozent waren für mich eine Art Ablass der pharmazeutischen Industrie an die Krankenkassen. Die patentgeschützten Präparate, für die die Pharmaunternehmen seinerzeit die Preise selbst festlegen konnten, haben über Jahre hinweg für irrsinnigen Profit gesorgt. Daher sollte man zumindest die 16 Prozent aufrechterhalten, solange nicht diese teuren Präparate patentfrei und damit generisch vieler im Markt angebotenen Mittel verordnet werden können. Dass sieben Prozent dies kompensieren, halte ich für völlig irreal. Es ist sicherlich eine Regelung für die Zukunft, auch wenn die pharmazeutischen Firmen vermutlich auch darüber klagen. Aber Tatsache ist, dass sie die Evidenz ihrer Präparate nie vernünftig nachgewiesen haben.
Wäre es nicht dennoch genauso sinnvoll, den Bestandsmarkt mit den auslaufenden Patenten außer Acht zu lassen und sich auf die Bewertung neuer Medikamente zu konzentrieren? Das könnte ja unbeschadet davon laufen. Natürlich ist die Regelung für neue Arzneimittel ausgesprochen wichtig, so kann ein neues patentgeschütztes Arzneimittel direkt in den Festbetrag eingeordnet werden, wenn für dieses Mittel ein patientenorientierter Nutzen fehlt. Nur bin ich mir sicher, dass dies auch bei vielen Arzneimitteln des Bestandsmarktes der Fall wäre und der Festbetrag somit kostendämpfend wirken würde. Aber ja, was die Nutzenbewertung neuer Arzneimittel betrifft, gehe ich völlig d’accord, dies sollte nicht verändert werden. Trotz der Probleme, die es gibt – etwa Anpassungs- und Übergangsprobleme –, entwickelt sich dieses Verfahren sehr gut. Das AMNOG ist für mich auch deshalb so wichtig, weil es eine qualitätsorientierte Struktur aufweist. Wir müssen viel mehr die Chance nutzen, Arzneimittel unter Qualitätsaspekten auf dem Markt zu erhalten, die dann auch ihr Geld wert sind.
Wie viel sollte uns Qualität wert sein? Über Qualitätsdefinitionen komme ich dann ganz schnell zu Preisdefinitionen und -diskussionen. Wenn ein Arzneimittel mit hoher Evidenz zugelassen wird, sollte es für die GKV durchaus erträglich sein, dafür entsprechend zu zahlen. Wenn ich allerdings sehe, dass Arzneimittel in den Markt kommen, die nur weil sie neu sind, teuer sein dürfen, und dies mit Qualität nichts zu tun hat, dann fällt es mir schwer, Argumente zu finden, warum der Preis so hoch gestaltet ist. Das Qualitätsargument wird in unserem System leider stark vernachlässigt. Es muss Anreize für Qualität geben, das AMNOG bietet so einen Anreiz: value for money and money for value.
Es gibt ja noch viele andere Steuerungsinstrumente im Arzneimittelbereich. Nehmen wir die Rabattverträge. Ein wirksames Instrument?
Vielleicht vorab: Wenn ich das richtig sehe, haben wir derzeit 27 Regelungen im Bereich Arzneimittelmarkt, die aus dem SGB V, den Arzneimittelrichtlinien und dem Gemeinsamen Bundesausschuss kommen und die sich zum Teil widersprechen oder aufheben, was generell ein Problem ist. Was explizit Rabattverträge angeht, sind sie durchaus ein wirksames Mittel und ich halte sie grundsätzlich als Verhandlungslösung auch richtig. Sinnvoll ist auch die Entwicklung, dass die Krankenkassen zunehmend darauf setzen, mehrere Hersteller einzubinden. Nur finde ich es nicht immer richtig, wie sie gestaltet sind. Zum Beispiel gibt es aus meiner Sicht gewisse Wirkstoffe, die nicht in Rabattverträge eingeschlossen werden sollten. Schade ist auch, dass die Preissensibilität beim Arzt sowie die Mitgestaltungsmöglichkeit beim Patienten verloren gegangen sind. Aber man lernt ja aus den Problemen und entwickelt die Rabattverträge weiter. Nur was ich mir trotzdem wünschen würde, ist eine wissenschaftliche Evaluation der Rabattverträge. Unser Gesundheitswesen ist leider geprägt von Evaluationsdefiziten. Praxisgebühr, Disease-Management-Programme, diagnosebezogene Fallgruppen, Selektiv-, Hausarzt- oder Rabattverträge – nirgends gibt es eine unabhängige Evaluation.
Steuerungsinstrument belassen wollen?
Ja, ich würde sogar weitergehen und kassenindividuelle Positivlisten vorschlagen, über die verhandelt werden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Kassen ein Arzneimittelsortiment definieren, verhandeln und ihren Versicherten zur Verfügung stellen, weil sie von der Qualität der Arzneimitteltherapie überzeugt sind. Fest steht, die Rabattverträge sind wichtig. Sie konkurrieren aber leider mit dem Festbetragsmodell, da hier Erstattungsobergrenzen für bestimmte Wirkstoffe eingeführt werden, die bei den gleichen Wirkstoffen in den Rabattverträgen deutlich unterboten werden – nur, niemand außerhalb der jeweiligen Kassen und der betroffenen Hersteller weiß, um wie viel. Dieser Konflikt lässt sich eigentlich nur über generelle Preisverhandlungen auflösen. Eines darf man insgesamt nicht vergessen: Alle Dinge, die ins Gesundheitssystem eingeführt werden, haben eben auch Begleiterscheinungen.
Wie sieht es mit Innovationen aus? Die Pharmaindustrie moniert, Forschung hierzulande würde sich nicht lohnen, Deutschland sei zu überreglementiert.
Bei Innovationen habe ich überhaupt kein Mitgefühl gegenüber den Pharmaherstellern. Erstens muss man sagen, dass der Anteil der wirklichen Innovationen relativ gering ist. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen des AMNOG, da ist ein erheblicher Zusatznutzen ausgesprochen selten. Zweitens gilt, und da bin ich ziemlich ungnädig gegenüber der Industrie: Wer nicht forscht, wird abgehängt. Mit dem AMNOG haben wir jetzt, und andere Länder schon längst, eine Barriere aufgebaut, um Innovationen bewerten zu können. Dabei hält das AMNOG auseinander, ob es sich um eine therapeutische, technologische oder ökonomische Innovation handelt. Es differenziert, ob man es wirklich mit einer Innovation zu tun hat. Wenn an dieser Stelle jemand sagt, wir seien ein innovationsfeindliches Land, dann möchte ich das bitte an einem Beispiel erkennen. Schließlich zahlt die GKV auch für wirkliche Innovationen.
Antibiotika werden als Beispiel angeführt.
Tatsächlich gibt es immer mehr Antibiotikaresistenzen, aber diese sind auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ein Ergebnis langjähriger, zum Teil nicht notwendiger Antibiotika-Verwendung. In der Vergangenheit wurde oftmals ein laxer Umgang mit Antibiotika gepflegt, zudem wurden neue Antibiotika bei Krankheiten eingesetzt, bei denen auch bewährte Antibiotika hätten genutzt werden können. Dazu kommt, dass heute nahezu 100 Prozent aller Antibiotika-Verordnungen generisch beantwortet werden. Somit gibt es aus ökonomischer Sicht für die Hersteller keinen Anreiz mehr zu forschen. Diese Problematik wird es wahrscheinlich auch an anderen Stellen zunehmend geben.
Wie lässt sich gegensteuern, ohne dass notwendige Forschung ausgebremst wird?
Ich würde mir eine Initiative auf europäischer Ebene wünschen, die eine Art Priorisierungsliste fordert nach dem Motto: Wo ist Forschung dringend erforderlich? Dann muss man überlegen, wie man die pharmazeutische Industrie dazu bewegt, an diesen Stellen zu forschen und ihr Know-how einzusetzen. Man kann über Public Private Partnership nachdenken, es sollte durchaus national finanzierte Forschungsprogramme geben, um solche Lücken zu schließen: Die Industrie stellt die Infrastruktur, die Forschungsgelder werden innerhalb der Europäischen Union aufgebracht, um zum Beispiel neue Antibiotika auf den Markt zu bringen. Möglicherweise könnten sogar die Patente der GKV oder dem jeweiligen Land gehören. Dabei würde ich mich weiterhin auf die GKV als einen kraftvollen Nachfrager verlassen, der mit Blick auf die Versorgung die Chance hat zu differenzieren, welche Arzneimittel tatsächlich in den Markt sollten. Daher könnte auch die GKV den Vorschlag einer Priorisierung von Forschungsnotwendigkeiten durchaus mitformulieren.
Muss zeitgleich das Verordnungsverhalten von Ärzten und deren Zusammenarbeit mit Apothekern optimiert werden?
Der Kostenanteil aufgrund falscher Verordnungen und Einnahme von Medikamenten ist relativ hoch. Allein die Adhärenzproblematik macht einen großen Bereich aus. Adhärenz bedeutet, dass verordnete Medikamente wirklich so eingenommen werden, wie sie sollten. Hier kommt es darauf an, Unterstützung durch den Arzt und Apotheker zu bekommen. Eine Studie aus 2012 zeigt, dass Patienten, die sich von Arzt und Apotheker beraten lassen, das Medikament am ehesten so einnehmen, wie sie sollten. Daher halte ich Adhärenz und auch die Verschwendung von Arzneimitteln für ein ganz wesentliches Problem des Informationsdefizits von denen, die Entscheidungen treffen. Weder Arzt noch Apotheker können sich entlasten mit dem Hinweis auf den Beipackzettel. Es ist deren ureigene Aufgabe, darüber zu informieren, wie das Medikament wirkt, warum es notwendig ist und welche unerwünschten Nebenwirkungen auftreten könnten. Es ist ein Informationsdefizit, das vielfach in der ärztlichen Praxis beginnt und leider in der Apotheke weitergeführt wird.
Wie lässt es sich erfolgreich beheben?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Angefangen bei Leitlinien, die in eine verständliche, patientenfreundliche Sprache übersetzt werden. Darauf zu achten, dass wirklich nur Arzneimittel verordnet werden, die auch tatsächlich notwendig sind. Und dann eben die notwendige Aufklärung seitens der Ärzte und Apotheker. Gerade die Apotheker haben eine ganz wichtige Aufgabe in Sachen der Arzneimitteltherapie. Wenn sie evaluieren würden, dass sie der Aufgabe gerecht werden und Nutzen stiften – was zum Beispiel messbar wäre in weniger unerwünschten Wirkungen, Krankenhausaufenthalten oder Behandlungsnotwendigkeiten –, dann sollte man auch darüber nachdenken, wie diese Leistung zu honorieren wäre.
Ein Apotheker schlüpft ja auch in die Rolle des Verkäufers. Wie lässt sich das mit einer bedarfsgerechten Arzneimitteltherapie vereinbaren?
Zunächst ist zu sagen, dass der Apotheker seinen wesentlichen Umsatz mit rezeptpflichtigen Mitteln macht, etwa 80 Prozent wird von der GKV getragen. Im Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel aber, und das kritisiere ich nachdrücklich, sollte er viel mehr filtern gegenüber der Industrie und Werbung. Wir sehen, dass da sehr viel Geld in die kundenorientierte Werbung gesteckt wird. Umso mehr ist es die Aufgabe des Apothekers, hier zu informieren, ansonsten hat er seinen Beruf verfehlt. Man könnte durchaus über Anreize nachdenken. Muss die Krankenkasse beispielsweise mit allen Apotheken Verträge haben? Ich meine nein. Es könnte ähnlich wie bei den Selektivverträgen mit Ärzten bestimmte Qualifikationsanforderungen geben. Denn auf Dauer wird man nicht mehr alle im Kollektivvertrag gleichermaßen begünstigen können, wir brauchen eine Differenzierung des Berufs anhand bestimmter Qualifikationen. Leider wurde die Rolle des Apothekers jahrelang sträflichst vernachlässigt. Dabei ist er jemand, der sich am Bedarf und an den Bedürfnissen der Patienten orientieren sollte. Das ist zumindest das, was ich erwarte.
Was erwarten Sie von den Krankenkassen?
Ich wünsche mir, dass die Krankenkassen ihre Kraft nutzen, Versorgungskonzepte zugunsten der Patienten zu entwickeln, diese Kraft würde ich nicht unterschätzen. Da geht es um spezifische Vertragsangebote zum Beispiel bei Krankheiten wie MS, Rheumatoide Arthritis, Psoriasis oder auch in der Onkologie, also speziell dort, wo neue Arzneimitteltherapien eingeführt und auch begleitet werden müssen. Dies gilt aber auch für seltene Erkrankungen und für Erkrankungen wie Mukoviszidose, wo die Transition von der „Kinderversorgung“ zur „Erwachsenenversorgung“ oftmals im Argen liegt. Die Versorgungsforschung sollte hier auch stärker genutzt werden, um Unter-, Über- und Fehlversorgung zu erkennen und ausgleichen zu können. Ich würde die Kraft der Kassen nicht unterschätzen. Die GKV ist ein wichtiger Motor für Innovationen und letzten Endes ein zuverlässiger Finanzier von therapeutischem Fortschritt – und das nicht nur in der Arzneimitteltherapie.

Beide Fotos: vdek/Ralf Vorderbrück
Prof. Dr. Gerd Glaeske, geboren am 13. Mai 1945, ist von Haus aus Apotheker. Er studierte Pharmazie in Aachen und Hamburg, wo er 1978 auch promovierte, bevor er von 1981 bis 1988 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und später Abteilungsleiter am Bremer Institut für Prävention und Sozialmedizin (BIPS) arbeitete, das die erste Arzneimittelstudie in Deutschland überhaupt hervorbrachte. Hier entstand auch 1983 sein Buch „Bittere Pillen“, der erste typische Patientenratgeber für Arzneimittel. 1988 ging er für vier Jahre zur AOK Kreis Mettmann, bevor er zunächst 1993 als Abteilungsleiter zum Verband der Angestellten-Krankenkasse e. V. (VdAK) wechselte, 1996 dann zur BARMER Ersatzkasse.
1999 entschied Glaeske sich für eine universitäre Laufbahn und hat seitdem die Professur für Arzneimittelanwendungsforschung am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen inne. 2003 wurde er für sieben Jahre in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen berufen. Zudem übernahm er 2007 den Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirats zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim Bundesversicherungsamt (BVA), trat jedoch im Frühjahr 2008 aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Politik und dem BVA von diesem Amt zurück. Daneben ist er Mitglied in unterschiedlichen Institutionen im Bereich der Arzneimittel- und Versorgungsforschung.



 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2024
Landesbasisfallwerte 2024 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit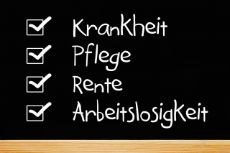 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


