
Eingang der Kinderklinik am Campus Virchow-Klinikum der Charité-Universitätsmedizin Berlin.
Eine Krebsdiagnose bei Kindern ist ein Schock, und sie bringt den Alltag der betroffenen Familien für lange Zeit durcheinander. Ein Besuch in der kinderonkologischen Klinik der Charité-Universitätsmedizin Berlin, wo Kinder mit Krebserkrankungen und Erkrankungen des blutbildenden Systems behandelt werden.
Es war nur eine Beule an der linken Hand von Jessica Z. Sie schmerzte und wurde immer größer. Am 7. März 2013 ging Melanie Z. deshalb mit ihrer elfjährigen Tochter zum Kinderchirurgen. Der überwies Jessica an die Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie am Campus Virchow-Klinikum der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Eine Biopsie brachte die genaue Diagnose: bösartiger Weichteiltumor.
„Ich mache mir Vorwürfe, dass wir erst einige Wochen gewartet haben, bevor wir zum Arzt gingen“, sagt die 38-jährige Melanie Z. „Aber man denkt sich doch nichts bei einer Beule.“ Jessica bekam sofort Chemotherapie, litt unter starker Übelkeit und Erbrechen, nach den zwei Wochen des ersten Behandlungsblocks fielen ihr die Haare aus. „Es war schlimm“, sagt Jessica. „Nicht zu wissen, was die Diagnose genau bedeutet und was jetzt alles auf mich zukommt.“ Im nächsten Halbjahr folgten acht weitere Blöcke Chemotherapie und eine Strahlenbehandlung. Dann wurde Jessicas Hand am Klinikum Stuttgart operiert, das auf solche Eingriffe spezialisiert ist. Das abgestorbene Tumorgewebe wurde entnommen und die Hand mit Unterarmgewebe rekonstruiert.
Vom Krebs aus dem Alltag gerissen
Es ging alles sehr schnell. Die dramatische Diagnose riss Mutter und Tochter aus ihrem normalen Alltag. Jessica besucht jetzt die Krankenhausschule, die individuellen Unterricht anbietet. Sie will hier die fünfte Klasse abschließen. Melanie Z. ist seit der Diagnose ihrer Tochter krankgeschrieben. Sie war in einem Montagebetrieb als Assistentin der Betriebsleitung tätig, der hat ihr nach drei Monaten gekündigt.
Und die Krankheit wird die Familie noch lange begleiten. Denn Jessica hatte einen Rückfall. An der Entnahmestelle für die Handrekonstruktion bildete sich eine neue Beule, die rasend schnell wuchs. Da stand der Rehatermin für Jessica eigentlich schon fest. Jetzt liegt vor ihr noch mal ein halbes Jahr mit Chemotherapie, Bestrahlung, Operation. Melanie Z. kommen die Tränen, als sie das erzählt. „Ich wollte es nicht glauben und habe gehofft, dass die Ärzte sich irren.“
Es ist bewundernswert, wie viel Ruhe Jessica ausstrahlt, während sie die Hand der weinenden Mutter hält, eine große graue Strickmütze auf dem Kopf. „Jessica ist viel stärker als ich“, sagt die Mutter. Auf die Frage, was ihr Kraft gibt, sagt Jessica: „So viel Zeit wie möglich mit der Familie verbringen. Und schöne Dinge machen, öfters mal ins Kino gehen. Wir unternehmen auch viel mit den Nachbarn. Die sind sehr hilfsbereit und eine große Unterstützung.“
Die kinderonkologische Klinik der Charité umfasst zwei intensivmedizinisch ausgelegte Stationen, eine Tagesklinik, eine Ambulanz, ein sozial-pädiatrisches Zentrum und einen Forschungsbereich. Behandelt werden hier Krebserkrankungen und Erkrankungen des blutbildenden Systems. 19 Ärzte, 50 Pflegepersonen und acht Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes betreuen rund 16.000 Fälle pro Jahr, alle Vorstellungstermine und stationären Aufnahmen zusammengezählt. Etwa 120 Kinder werden jährlich mit einer Neudiagnose eingewiesen, 30 erleiden einen Rückfall.
Jetzt um die Mittagszeit geht es hier sehr lebhaft zu. Kinder fahren mit Bobby Cars herum, es gibt bunte Luftballons und Wandbilder. Auf den Gängen stehen Tische und Stühle, an denen die Familien zu Mittag essen. Nur die fahrbaren Infusionsständer, die manch einer hinter sich her zieht, trüben das Bild. Und dass die meisten Kinder keine Haare haben.
Für neu aufgenommene Familien gibt es ein Kennenlerngespräch mit dem psychosozialen Dienst, um Unterstützungsbedarf abzuklären. „Wir halten beständig Kontakt zu den Eltern“, sagt Psychologin Dr. Christine Gürtler, 41. „Das ist wichtig, denn viele sind im Dauerstress, weil sie sich um das Kind und dessen Pflege kümmern müssen. Dabei kann der eigene Beratungsbedarf untergehen.“ Neben psychologischer Unterstützung gibt es auch Hilfe durch Sozialarbeiter. Oft sind finanzielle Einbußen zu bewältigen. Es müssen Dinge geklärt werden, wie einen Schwerbehindertenausweis oder Sozialleistungen wie Pflegegeld zu beantragen. Je nachdem gibt es die Möglichkeit einer Haushaltshilfe und Hausunterricht.
Die Kinder müssen damit zurecht kommen, dass ihr ganzer Alltag aus den Fugen geraten ist und sie ständige Untersuchungen und unangenehme Prozeduren erleben. Und natürlich haben sie mit den Folgen der Chemotherapie zu kämpfen. Haarausfall, Appetitlosigkeit, Übelkeit sind nur einige davon. Bei vielen kommt es auch zu Komplikationen. Die häufigste ist die Sepsis. Bei dieser Entzündungsreaktion haben die Kinder keine Immunabwehr mehr und müssen deswegen stationär betreut werden. Hier auf den Stationen gibt es ständig veränderte Situationen, vieles ist nicht planbar. Keine leichte Aufgabe für das Personal.
„Ich will keinen Schlauch in der Nase mehr!“, sagt die dreijährige Emma-Luise W. „Da kann ich den Nuckel nicht richtig nehmen.“ Emma-Luise war erst zwei Jahre alt, als sie letzten Sommer die Diagnose akute lymphatische Leukämie bekam. Da es mit der oralen Medikamentengabe nicht klappte, hat sie eine Magensonde. „Es gibt keinen richtigen Alltag mehr“, sagt ihre Mutter Maxi U., 27, Hotelfachfrau. „Meine Berufstätigkeit kann ich nicht mehr ausüben, es richtet sich alles nach Emma. Wenn es ihr morgens gut geht, kann es trotzdem sein, dass wir abends auf Station müssen, weil sie fiebert.“ Auch soziale Kontakte sind schwierig, da nichts planbar ist und öffentliche Orte wegen Emma-Luises schwacher Immunabwehr gemieden werden müssen. Die zahlreichen Untersuchungen und Therapien, die sie über sich ergehen lassen musste, spielt sie oft mit ihren Puppen nach. Die sind alle schwerkrank, brauchen Pflaster, Katheter und Nasenschläuche, so wie sie zeitweise.
Etwa 2.000 Neuerkrankungen pro Jahr
Deutschlandweit gibt es etwa 2.000 Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen pro Jahr. Die häufigsten Diagnosen sind Leukämien, Hirntumoren und Neuroblastome, also Tumoren des peripheren Nervensystems. Die akute Behandlungsdauer beträgt sechs Monate bis ein Jahr. Die geplanten stationären Therapieblöcke dauern zwischen einem und zehn Tagen, bei Komplikationen fallen sie länger aus. Ein bis eineinhalb Jahre nehmen die Kinder anschließend zu Hause Chemotherapie in Tablettenform und ihre Blutwerte werden alle ein bis zwei Wochen kontrolliert. Es folgt ein strukturiertes Nachsorgeprogramm bis zum 18. Lebensjahr.
Prof. Dr. med. Angelika Eggert, 46, ist Vorsitzende der Gesellschaft für Kinderonkologie und -hämatologie (GPOH) und seit Juli 2013 Klinikdirektorin der Kinderonkologie an der Charité. „Kinderonkologische Erkrankungen lassen sich gut erforschen, weil die genetischen Veränderungsmuster der Tumorzellen anders als bei Erwachsenen einfacher und noch frei von Umweltfaktoren sind“, sagt Eggert. „Mehr als 95 Prozent der Krebsfälle bei Kindern werden in klinischen Therapieoptimierungsstudien der Fachgesellschaft behandelt, das heißt unabhängig von der Pharmaindustrie. Dieses Konzept sorgt für eine hohe Behandlungsqualität.“
Die Heilungschancen für krebskranke Kinder liegen mittlerweile bei 80 Prozent. Sie bekommen deutschlandweit, je nach Erkrankung sogar weltweit, ein identisches Behandlungskonzept. „Seit den 60er Jahren wurde eine stetige Verbesserung und Anpassung des Behandlungsschemas sehr rigide durchgezogen. In der Erwachsenenmedizin haben wir das nicht, weil es keinen vergleichbaren Zusammenschluss der behandelnden Kollegen gibt“, sagt Eggert. Aber trotzdem: „Immer noch stirbt jedes fünfte Kind mit einer solchen Diagnose.“
Eine weitere Herausforderung in Zeiten knapper Kassen: Der psychosoziale Dienst muss an vielen Orten zur Hälfte – wie hier – oder sogar komplett über Spenden finanziert werden. Das gelte, so Eggert, auch für zusätzliche Angebote, die hier ermöglicht werden, um eine kindgerechte Atmosphäre zu schaffen: eine Erzieherin, Kinderköche und Geschichtenerzähler.
In der letzten Zeit halten vermehrt Immuntherapien und molekular gezielte Medikamente, also Antikörper oder kleine Inhibitoren, Einzug in die Krebsbehandlung. Basis wird aber noch lange die konventionelle Chemotherapie sein. „Es wäre toll, wenn wir irgendwann auf die Chemotherapie mit ihren zahlreichen Nebenwirkungen verzichten könnten“, sagt Eggert. „Molekular gezielte Medikamente sind besser verträglich, weil sie gezielter Strukturen auf der Oberfläche von Tumorzellen angreifen und kein gesundes Körpergewebe.“



 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2024
Landesbasisfallwerte 2024 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit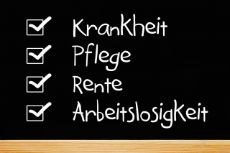 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


