Die große Koalition lenkt seit gut einem Jahr die Geschicke in der Gesundheitspolitik. Mit einem enormen Tatendrang, wie die Zahl der Gesetzgebungsprozesse und -vorhaben zeigt. Der Fahrplan lautet Koalitionsvertrag – doch wohin geht die Reise tatsächlich?
Die Gesundheitspolitik der Bundesregierung läuft wie ein gut geschmiertes Räderwerk: schnell, geräuschlos, effizient. Was hat die große Koalition in dem knapp einen Jahr Regierungszeit nicht alles angefasst: zweimal die Pharmapreisregulierung überarbeitet, die Finanzierung der Krankenkassen mittels Zusatzbeitrag neu gestaltet, das erste Gesetz zur Pflegereform verabschiedet, deren zweite Stufe auf den Weg gebracht. Kaum ist die „Versorgungsstruktur reformiert“, liegt der Entwurf für deren „Stärkung“ auf dem Tisch, samt einer Vier-Wochen-Frist für den Facharzttermin, Zweitmeinungsverfahren und einem neuen Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Als wäre das nicht alles schon genug, ist auch der Entwurf für das seit 2004 angekündigte Präventionsgesetz auf dem Weg. Auch der für ein Gesetz zum besseren Einsatz der Telematik im Gesundheitswesen dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Über die Reform der Krankenhausfinanzierung verhandeln Bund und Länder. Das ist Gesundheitsgesetzgebung, als gäbe es kein Morgen mehr. Wie in Sieben-Meilen-Stiefeln durchmessen Union und SPD den Koalitionsvertrag, als treibe sie die Angst um, sie könnten spätestens 2015 alle Gemeinsamkeiten aufgebraucht haben. Dabei sollten die doch bis 2017 reichen, erst dann wird der nächste Bundestag gewählt.
So viel Reform müsste Diskussionen auslösen. Debatten darüber, ob die Regierenden die richtigen Fragen stellen und passende Antworten darauf finden, ob der eingeschlagene Weg notwendig ist, ob die gewählten Methoden hilfreich sind. So war es in der Vergangenheit, ob der Gesundheitsminister nun Horst Seehofer (CSU), Ulla Schmidt (SPD) oder Daniel Bahr (FDP) hieß. Nur bei Hermann Gröhe (CDU) und der großen Koalition ist alles anders.
Es liegt eine tiefe Ruhe über der deutschen Gesundheitspolitik. Die große Koalition mit ihrer übersatten Mehrheit erstickt jede kritische Debatte. Das gilt zwar nicht in allen Politikbereichen, wohl aber in der Gesundheitspolitik. Minutiös wird der Koalitionsvertrag abgearbeitet, Absatz für Absatz, Satz für Satz, Wort für Wort. Nicht mehr und nicht weniger. Wer als Koalitionspolitiker dagegen Einwände formuliert, bekommt Anrufe von oben, freundlich, aber sehr bestimmt.
Niemand soll die Harmonie dieser Gesundheitspolitik nach Fahrplan stören. Die Opposition ist zu leichtgewichtig. Den Lobbyisten fehlt ein Resonanzboden, der Kritik verstärken könnte. Und auch die Lobby ist angesichts der Übermacht der Regieren-den lieber auf der Hut. Ohne Kontroverse sind auch die Medien weitgehend desinteressiert. Gesundheitspolitik wird mehr und mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Für alles das gibt es Gründe. Die liegen nicht nur in der großen Koalition, sondern auch in den handelnden Personen, nicht zuletzt in der immer noch blendenden Verfassung des Gesundheitswesens.
Gesundheitsminister Gröhe hat sich als routinierter Technokrat schnell in das neue Metier eingearbeitet. Die hohe Schlagzahl zeigt, dass er und seine Mannschaft das Haus im Griff haben. Möglichkeiten zur Schärfung seines Profils bietet das Amt in der Konstellation indes eher wenig. In der Debatte um die Straffreiheit für Ärzte im Fall der Sterbehilfe, die nicht im Koalitionsvertrag geregelt ist, hat er als Konservativer schnell eine klar ablehnende Position bezogen. Doch das Thema wird fraktionsübergreifend debattiert. Es eignet sich kaum dafür, sich einem breiteren Publikum bekannter zu machen. Ähnlich ist es mit der Ebola-Seuche. Da kann Gröhe zwar viel reden, Machtinstrumente aber hat er nicht: Flugzeuge und Sanitäter stehen unter dem Kommando der Verteidigungsministerin, der Nationale Ebola-Koordinator kommt aus dem Außenministerium und für die Notfallpläne und Vor-Ort-Behandlung im Land sind die Bundesländer verantwortlich.
In der Koalition ist Gröhe der erste Umsetzer des Regierungsvertrages. Die Kanzlerin, die ihn im Kanzleramt und als früheren Generalsekretär ihrer CDU aus allernächster Nähe kennt, kann sich einstweilen sicher sein, dass es mit ihm an der gesundheitspolitischen Flanke ruhig bleibt. Die beiden tonangebenden Gesundheitspolitiker aus Union und SPD tun ein Übriges dazu. Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) haben sich schon vor einem Jahr als ministrabel gehalten. Beide wollen nach 2017 gerne durchstarten und mehr Verantwortung in Fraktion oder Regierung übernehmen. Deshalb stellen sich beide lieber in den Dienst von Partei und Fraktion, als dass sie sich durch Mäkeleien am Koalitionspartner bekannter machen oder durch eigennützige Aktionen anecken. Selbst dem bayerischen Löwen ist das Brüllen vergangen, seitdem man der gesundheitspolitischen Debatte mit dem Ausklammern finanzpolitischer Kontroversen im Koalitionsvertrag die Weisheitszähne gezogen hat.
So schön wie derzeit ist Gesundheitspolitik aber nur, weil die großen Verteilungs- und Finanzierungskonflikte der Vergangenheit einstweilen wirklich Vergangenheit sind. Zwar wirft die Koalition das in der vergangenen Wahlperiode so schön angesparte Geld nicht mit vollen Händen zum Fenster hinaus. Doch sie dichtet auch die Löcher nicht ab, aus denen die Reserven aus dem Geldspeicher sickern, eher bohrt sie neue: 300 Millionen Euro jedes Jahr für einen Innovationsfonds, dessen Wirkung und Kontrolle durch den G-BA man mehr als kritisch beurteilen muss. Eine halbe Milliarde Euro dürften die Honoraranpassungen für die Ärzte in Nordrhein und Westfalen sowie einigen anderen Regionen kosten, die sich unterdurchschnittlich bezahlt fühlen. Für sie zahlt sich diesmal aus, dass fast die gesamte gesundheitspolitische Hautevolee aus Nordrhein-Westfalen stammt. Der warme Regen aus der Gießkanne des Versorgungszuschlags geht auch künftig mit 500 Millionen Euro über die Krankenhäuser nieder (auch wenn der zum großen Teil über die Kliniken refinanziert wird). Selbst mit den Hebammen legt sich die Koalition nicht an: Für deren Fehler bei der Geburt und die Bezahlung von Therapie und Rehabilitation sollen nicht mehr die Haftpflichtversicherer, sondern die Gemeinschaft der Beitragszahler aufkommen.
Die Krankenkassen geraten damit zwangsläufig unter einen wachsenden Finanzdruck. Zwar werden die allermeisten durch Griff in die Reserven oder eine kreative Buchführung vermeiden, einen Zusatzbeitrag oberhalb des Durchschnitts zu verlangen. Doch wie lange geht die Party noch? Schon in diesem Jahr sind die Ausgaben den Einnahmen davongelaufen. Noch wächst die Beschäftigung und gute Tarifabschlüsse lenken viel Geld zusätzlich ins System. Das alles wird nicht verhindern, dass zum Wahljahr 2017 sehr viele Kassen einen höheren Zusatzbeitrag als heute verlangen müssen. Ob die Koalition das eingepreist hat? Oder will sie vorher den Gesundheitsfonds plündern, falls der Finanzminister noch etwas übriggelassen hat?










 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit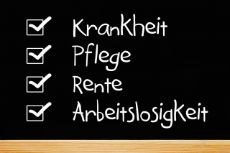 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


