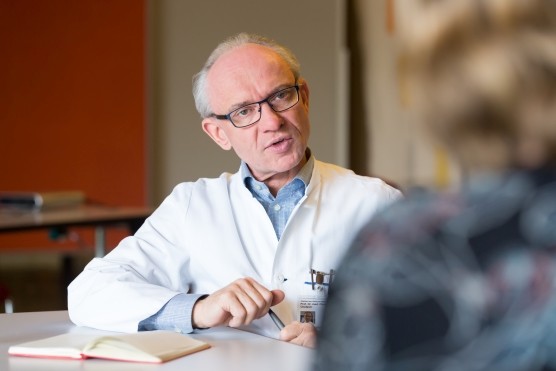
Prof. Dr. Christoph Dodt ist Chefarzt des Notfallzentrums am Klinikum Bogenhausen des Städtischen Klinikums München und Präsident der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e. V. (DGINA). Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht er über den Alltag in deutschen Notaufnahmen und darüber, was sich an den finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen ändern sollte.
Herr Prof. Dr. Dodt, was fasziniert Sie an Ihrem Beruf?
Es gibt nichts Schöneres als in einer Situation helfen zu können, in der die Bedrohung am größten ist. Dazu muss die Medizin effizient sein und Entscheidungen müssen rasch getroffen und umgesetzt werden. Diese Merkmale der Notfallmedizin faszinieren mich am meisten. Dazu kommt die Interdisziplinarität: Ich habe mit allen Fächern der Medizin zu tun und koordiniere die verschiedensten Fachgruppen zum Wohle des Patienten.
Wie viele Notfälle betreuen Sie und wie ist Ihre Abteilung ausgestattet?
Täglich kommen um die 100 Notfälle, pro Jahr etwa 38.000. Eine Besonderheit bei uns ist: Wir haben als großstädtisches Krankenhaus und Maximalversorger sehr viele schwer kranke Patienten. Wir verfügen über 16 Bettenplätze, davon sechs Plätze mit der Ausstattung einer Intensivstation, sieben Untersuchungsräume, einen Schockraum und eine Röntgeneinheit. Es sind immer mindestens drei Ärzte und fünf Pflegekräfte vor Ort. Wie läuft die Notaufnahme eines Patienten ab? Unser Personal ist dafür verantwortlich, die ersten Stunden des Patienten in der Klinik zu organisieren und eine optimale Versorgung für seine Gesundheitsstörung zu garantieren. Wenn es notwendig ist, die Fachabteilungen hinzuzuziehen, dann wird dies getan. Wenn eine allgemeinärztliche Behandlung ausreicht oder zu einem späteren Zeitpunkt eine fachärztliche Versorgung notwendig ist, entlassen wir die Patienten wieder ohne Hinzuziehen einer Fachabteilung. Als allererstes muss man daher einschätzen: Wie bedroht ist der Patient? Unsere standardisierte Ersteinschätzung hat fünf Stufen. Stufe Eins ist die Lebensrettung mit Sofortmaßnahmen, Stufe Fünf sind Patienten, die auch in einer Arztpraxis hätten behandelt werden können. Sodann müssen die Ursachen der Symptome des Patienten geklärt werden. Denn die meisten kommen mit unspezifischen Beschwerden wie Atemnot oder Schmerzen. Die diagnostische Kompetenz ist ein wichtiger Aspekt der Notfallmedizin: mit wenigen Fragen herauszufinden, was hinter den Beschwerden steckt, und die richtigen Diagnostikschritte einzuleiten.
Sind solche Prozesse denn generell in deutschen Krankenhäusern standardisiert?
Nein, die Rolle einer Notfallversorgung mit eigenständiger Organisationsstruktur wird bisher noch nicht richtig wahrgenommen. Sie wird als eher störend angesehen, weil sie der Fachabteilung vorgeschaltet ist. Doch wir verstehen uns als diejenigen, die den Patienten schnellstmöglich in die richtige Fachabteilung bringen.
Sie fordern, eine einheitliche Definition von Notfall einzuführen.
Ich denke, für den Patienten ist das Entscheidende, dass am Anfang ein Generalist einschätzt, ob und welche fachärztliche Behandlung erforderlich ist. Hier ist eine einheitliche Definition des Notfalls wichtig. Letztlich ist jede akut aufgetretene Veränderung der Gesundheit ein Notfall. Deswegen ist das notfallmedizinische Spektrum breit: Ein Patient kann sich mit einer Banalität als schweren Notfall empfinden und kommt in die Notaufnahme. Auf der anderen Seite kann es sein, dass ein schwerkranker Patient eigentlich gar nicht ins Krankenhaus kommen will.
Brauchen solche Generalisten eine spezielle Ausbildung?
Auf jeden Fall. Eine standardisierte notfallmedizinische Ausbildung gibt es in Deutschland noch nicht, und das ist eines der Dinge, für die wir uns im Berufsverband einsetzen. Es gibt eine Zusatzausbildung für Notärzte, die in der Rettungsmedizin eingesetzt werden. Diese notärztlichen Kenntnisse sind jedoch nicht das, was der Arzt im Krankenhaus braucht. Der Notarzt auf der Straße muss garantieren, dass der Patient stabil bleibt und möglichst schnell das Krankenhaus erreicht. Die notfallmedizinische Tätigkeit in der Notaufnahme ist aber viel anspruchsvoller, weil in den Notaufnahmen auch eine diagnostische Abklärung der Gesundheitsstörung erfolgen muss. Es gibt eine europäische Ausbildungsleitlinie, die als Voraussetzung für eine gute Notfallmedizin mindestens ein halbes Jahr Intensivmedizin und zweieinhalb Jahre Praxiserfahrung in Notaufnahmen vorschreibt. Für ein Facharztcurriculum, wie es in vielen europäischen Ländern üblich ist, werden überdies zwei Jahre in notfallrelevanten Fächern vorgeschrieben, also im Wesentlichen Innere Medizin, Anästhesie, Kinderheilkunde und Chirurgie. Wir befürworten diesen Facharzt für Notfallmedizin mit europäischer Anerkennung, aber dafür gibt es in der gesamten Ärzteschaft noch keinen Konsens. Im Moment haben sich die in der Notfallmedizin beteiligten Fachdisziplinen darauf geeinigt, dass wir in Deutschland eine mehrjährige Zusatzweiterbildung brauchen, die einen Facharzt voraussetzt. Das würde dann im Durchschnitt allerdings sieben Ausbildungsjahre dauern.
Jährlich kommen über 20 Millionen Menschen in die Notaufnahme eines deutschen Krankenhauses. Etwa 20 Prozent könnten auch ambulant von niedergelassenen Ärzten versorgt werden. Warum gehen sie dennoch ins Krankenhaus?
Einige beispielsweise kennen das Gesundheitssystem nicht, was oft bei Migranten der Fall ist. Auch die Erwartungshaltung der Patienten spielt eine Rolle; im Krankenhaus können sie eine hohe diagnostische Sicherheit erwarten. Zudem können viele kassenärztliche Bereitschaftspraxen nicht rund um die Uhr betrieben werden. Letztendlich kann der Patient zwischen drei Möglichkeiten wählen, wie er sich im Notfall versorgen lässt: Er kann den Notarzt rufen, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, oder er kommt in die Notaufnahme. Diese Zersplitterung ist ein Problem. Man sollte es den Patienten einfach machen, indem sie nur eine Anlaufstelle haben, wo sie dann bedarfsgerecht abgestuft versorgt werden.
Wie ließe sich das organisieren?
Wir bräuchten Notfallzentren am oder im Klinikum, wo auch ambulante Ärzte tätig sind. Dort würde dann der Patient zuerst professionell eingeschätzt und aufgrund dieser Ersteinschätzung entweder der kassenärztlichen oder der Notfallversorgung des Krankenhauses zugeteilt. Derzeit hat jedoch maximal die Hälfte der deutschen Krankenhäuser eine standardisierte Ersteinschätzung. Der nächste Schritt ist, dass die Notfallmediziner in den Notaufnahmen dafür sorgen, dass die richtige Fachabteilung so schnell wie möglich gefunden wird, wenn eine stationäre Behandlung notwendig ist. Das ist der richtige Weg. Die zunehmende Spezialisierung der Medizin, die grundsätzlich sehr erfreulich ist, erfordert auch zusehends, dass am Anfang ein Arzt den Patienten richtig zuordnet – im ambulanten Bereich die Allgemeinärzte und im stationären Bereich die Notfallmediziner, die zusätzlich eine hohe Kompetenz in der Lebensrettung haben.
Der Sicherstellungsauftrag für die ambulante Notfallversorgung liegt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Wie könnte eine bessere Zusammenarbeit der Sektoren ambulant und stationär erreicht werden?
Etwa die Hälfte aller Fälle in der Klinik wird ambulant behandelt. Viele dieser ambulanten Fälle sind in der Klinik auch richtig aufgehoben – gerade im chirurgischen Bereich können nur die Notaufnahmen die ambulante Notfallversorgung rund um die Uhr garantieren. Bei den angesprochenen 20 Prozent aller Patienten, die unnötigerweise ins Krankenhaus kommen, sind wir eher ein Lückenbüßer für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. In vielen Krankenhäusern funktioniert eine direkt angeschlossene kassenärztliche Bereitschaftspraxis sehr gut. Wenn es Kooperationsprobleme gibt, sind das oft regionale Probleme. Die Gründe sind mir selbst nicht ganz klar, denn eigentlich profitieren Patienten und Ärzte. Patienten müssen nicht, was oft vorkommt, alle drei Säulen der Notfallversorgung durchlaufen. Und für Ärzte werden Dienstbelastungen reduziert und die Arbeit kann besser und effizienter aufgeteilt werden.
Zugleich sprechen Sie von einer chronischen Unterfinanzierung der ambulanten Notfallversorgung im Krankenhaus.
Die Vorhaltung einer Notfallstruktur ist hier der wesentliche Punkt. Im Moment ist es wie bei der Feuerwehr, wenn diese nach ihrem Wasserverbrauch bezahlt würde. Aber Sie brauchen eine Sicherstellungsstruktur, die finanziert sein muss, und auf dieser Basis muss eine falladäquate Finanzierung erfolgen. Im Moment ist das bei den ambulanten Patienten überhaupt nicht der Fall. Ein solcher Patient verursacht im Schnitt Kosten in Höhe von 130 Euro, das Haus erhält aber nur etwa 30 Euro.
Wie sieht es bei der stationären Notfallversorgung aus?
Durch das DRG-System wird die Diagnose bezahlt, nicht das Diagnostizieren. Die Notaufnahme wird also quersubventioniert über die stationären Patienten. Was passieren muss ist, dass die spezielle Notaufnahmeleistung beziffert wird z. B. durch die Schaffung eines eigenen Fachabteilungsschlüssels. Außerdem sollte man dem möglichen Fehlanreiz des DRG-Systems entgegenwirken, indem man finanzielle Anreize schafft, Patienten ambulant zu führen, die nicht unbedingt stationär behandelt werden müssen. Das könnte zum Beispiel mit einer Notfall-DRG für bestimmte Krankheitsbilder erreicht werden. Durch Schaffung einer zentralisierten Notaufnahme als eigenständige Versorgungseinheit ließen sich auch die tatsächlichen Kosten besser abbilden als in den derzeitigen unterschiedlichen Kostenstrukturen.
Sie sprechen sich auch dafür aus, die Notfallversorgung auf weniger Krankenhäuser zu konzentrieren.
Für bestimmte Notfälle brauchen Sie bestimmte Fachabteilungen, etwa für schwere Unfälle eine Unfallchirurgie, für Schlaganfälle eine Neurologie mit Schlaganfall-Einheit, für Herzinfarkte eine Kardiologie mit Herzkatheter, für Kinder eine Kinderabteilung. Nur wenige Häuser können all das vorhalten und abdecken, nämlich die Universitätsklinika, Maximalversorger und einige Schwerpunktversorger. Was deswegen notwendig ist, ist ein abgestimmtes Versorgungsnetz mit Versorgungszentren für spezifische Aufgaben, wo Patienten schnell dort hingebracht werden, wo man sie optimal behandeln kann. Derzeit gibt es in vielen Bereichen keine richtige Abstimmung der Häuser untereinander, was die abgestufte Versorgung betrifft.
Wie ließe sich das verbessern?
Wir brauchen einen gesetzlich festgelegten Auftrag und garantierte Qualität der Notfallversorgung in deutschen Krankenhäusern. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat jetzt den Auftrag bekommen, die Strukturqualität der Notfallversorgung zu definieren. Die Strukturierung über die Krankenhausplanung liegt in Länderhand, und deren Aufgabe ist es dann, Vorgaben für die Struktur der Notaufnahmen zu machen. Die wichtigsten Vorgaben sind aus meiner Sicht, dass ein an der Notfallversorgung teilnehmendes Haus über Fachabteilungen für Innere Medizin und Chirurgie verfügt, eine Intensivstation hat und rund um die Uhr Ultraschall- und Laboruntersuchungen durchführen kann. Außerdem brauchen viele Notfälle eine Computertomografie. Eine angebundene kassenärztliche Bereitschaftspraxis für die Ersteinschätzung des Patienten gehört ebenso dazu. Maximalversorger müssen zusätzlich jederzeit endoskopisch intervenieren können und über einen Herzkatheter, eine Schlaganfalleinheit und chirurgische Abteilungen zur Schwerstverletztenversorgung verfügen. Häuser, die nicht über diese Ausstattungen verfügen, sollten nicht an der Notfallversorgung teilnehmen.
Wie viele Krankenhäuser bleiben übrig?
Vorsichtig geschätzt würde ich sagen, nicht mehr als 600 Häuser.
Bei einer Konzentration der Notfallversorgung auf die Kliniken – wie viel Weg ist einem Notfallpatienten zumutbar?
Als Zeitvorgaben für die Notfallbehandlung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes plädieren wir als Fachgesellschaft für maximal zwölf Minuten. Bei elektiven Behandlungen der Grund- und Regelversorgung maximal 30 PKW-Minuten, der Schwerpunkt- und Maximalversorgung als Orientierungswert 60 PKW-Minuten. Eine klar abgestufte Notfallmedizin würde die Transportzeit des Rettungsdienstes verkürzen, weil der Patient gleich an die richtige Adresse kommt. Bei zwei Krankheitszuständen, nämlich bei akuten Blutungen oder Gefäßverschlüssen, geht es um jede Minute. Allerdings können Sie nicht jedes Krankenhaus für die adäquate Versorgung ausstatten. Da müsste dann also eher die Luftrettung ausgeweitet werden, als den Patienten in das nächstgelegene, aber nicht dafür ausgestattete Krankenhaus zu fahren. Das ist für den Patienten gefährlicher als eine fünf Minuten längere Flugzeit. Und wenn man es generell vergleicht: Die Ärzte der Bereitschaftsdienste müssen teilweise 40 Kilometer fahren, um einen Hausbesuch bei einem Patienten zu machen, der besser in eine zentrale Einheit gebracht worden wäre.
Müssen auch die Länder stärker zusammenarbeiten?
Es ist in der Tat auch eine planerische Aufgabe. Denn es wird dazu kommen müssen, dass sich einige Krankenhäuser vermehrt um das Notfallgeschäft kümmern und andere um das Elektivgeschäft. Die derzeitige Konkurrenzsituation zwischen dem Elektivbereich, der gut planbar und ökonomisch zu steuern ist, und der Notfallversorgung, deren Patienten das Elektivgeschäft mehr oder weniger stören, muss aufgelöst werden.
Würde das nicht auch helfen, die viel diskutierte Mengenproblematik im elektiven Bereich in den Griff zu kriegen?
Das könnte durchaus dazu beitragen.
Denken Sie, dass sich durch die geplante Krankenhaus-Reform der Länder etwas in der Notfallversorgung ändert?
Ich denke, dass die Politik die Probleme der Notfallversorgung erkannt hat. Allerdings wird das eine Aufgabe über die nächsten Jahre werden. Denn ein Netz für die Notfallversorgung zu knüpfen und den Versorgungsschwerpunkt in die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu bringen, beeinflusst so viele Bereiche des medizinischen Versorgungssystems, dass man mit Augenmaß und Geduld vorgehen muss.









 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit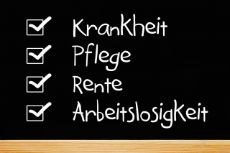 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


