
Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) dient der Koordination der Länderinteressen in gesundheitspolitischen Fragestellungen. Der Vorsitz der GMK wechselt jährlich, derzeit hat ihn das Land Rheinland-Pfalz inne mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) als dortiger Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht sie über die Rolle und den Einfluss der GMK in der Gesundheitspolitik, über die Erwartungen an die Krankenhausreform und über die Möglichkeiten einer zukunftssicheren guten Versorgung.
Sie sind seit November letzten Jahres Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz, und in diesem Jahr hat Ihr Bundesland den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) inne. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Länder?
Für die 88. GMK kann ich sagen, es lief sehr harmonisch. Wir haben 21 Beschlüsse gefasst und diese waren fast immer einstimmig. Das fand ich selbst beeindruckend, denn es wäre durchaus eine Situation wie Stadt- gegen Flächenland oder A- gegen B-Länder zu erwarten gewesen. Doch es bestand ein breiter Konsens, sowohl länder- als auch parteiübergreifend, auch in Bezug auf die Erwartungen an den Bund. Natürlich gibt es Reibungspunkte, aber wenn wir untereinander selbst stets uneinig wären, hätten wir kaum Gewicht gegenüber der Bundespolitik. Wenn wir Dinge voranbringen wollen, müssen wir eine Einigkeit erzeugen. Wir verstehen uns als Partner.
Wie groß ist der Einfluss der GMK gegenüber dem Bund?
Der Bund weiß, dass die Länder gestalten und entwickeln wollen. Dies erzeugt bereits einen gewissen Druck. Gleichzeitig nutzt die Bundesregierung diesen Schwung, wenn es um Themen geht, die sie auch selbst voranbringen will. Dies gilt zum Beispiel beim E-Health-Gesetz, da gibt es ja durchaus auch Widerstände. Wenn der Bundesgesundheitsminister aber spürt, die Länder gehen in dieselbe Richtung, dann kann man gemeinsam etwas auf den Weg bringen, was am Ende hoffentlich einen breiten Konsens erzeugt. Auch beim Thema Telematik funktioniert das schon gut.
Telematik ist ein Schwerpunktthema der 88. GMK. Was versprechen Sie sich von der Telematik, gerade auch für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz?
Zunächst ist wichtig zu betonen, dass das Telemonitoring eine Ergänzung der medizinischen Versorgung ist, es geht nicht um einen Ersatz. Wir brauchen beides – den Hausarzt und das Telemonitoring. Wenn dies deutlich gemacht wird, gewinnt man auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und als Instrument zur Sicherung der medizinischen Versorgung hat die Telematik gerade für ein Flächenland absolutes Potenzial. Wir können die Qualität der Versorgung steigern und gleichzeitig Kosten sparen. Dabei wird es immer darum gehen, erfolgreiche Projekte in die Regelversorgung aufzunehmen.
Bestehen erfolgreiche Telematik-Projekte in Rheinland-Pfalz?
Zwei Beispiele möchte ich nennen. Am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern läuft das E.He.R-Programm mit 100 Patienten aus dem Umland, die an einer Herzrhythmusstörung oder –insuffizienz leiden. Bislang mussten diese Patienten täglich zur Klinik fahren, um ihre medizinischen Daten erfassen zu lassen. Jetzt werden diese Daten über ein kleines Gerät an die Klinik beziehungsweise den behandelnden Arzt übermittelt. Sobald Unstimmigkeiten auftreten, wird der Patient gebeten, die Klinik aufzusuchen. Das entlastet Patient und Arzt und trägt zur Qualitätsverbesserung bei. Die Krankheitsverläufe wurden besser, weil sich der Krankheitsverlauf engmaschiger kontrollieren lässt. Ein anderes Projekt in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse, der Landesapothekerkammer und der Universitätsmedizin in Mainz betrifft die Arzneimitteltherapiesicherheit. Hier bekommt der Patient einen Medikationsplan zur Verfügung gestellt, den der Hausarzt oder Apotheker mit entsprechender Pin und unter Beachtung des Datenschutzes aktualisieren kann. Somit weiß man genau, was der Patient einnimmt und kann Wechsel- und Nebenwirkungen vorbeugen. Mit diesem Projekt sind wir derzeit Vorreiter, und wenn es gut läuft, wird der Bund es 2018 flächendeckend einführen.
Die GMK spricht sich dafür aus, in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Telematik, auch aufgrund dieser Erfahrungen vor Ort, eine nationale Strategie zu erarbeiten.
Solche Projekte, wie wir sie in Rheinland-Pfalz haben, haben die anderen Länder auch. Die Erfahrung und das Wissen liegen somit in den Ländern. Darüber muss ein Austausch stattfinden – am besten in unserer Bund-Länder-Arbeitsgruppe Telematik im Gesundheitswesen. Diese stellt auch sicher, dass die Länder umfassend einbezogen werden. Mit dem E-Health-Gesetz ist der Bund schon auf dem richtigen Weg. Nun muss das Thema E-Health mit Leben gefüllt werden und eine nationale Strategie erarbeitet werden. Da können sich die Länder hervorragend einbringen, denn im Grunde sind sie schon dabei und verfügen über das Wissen und die Erfahrung.
Zur Krankenhausreform hat es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gegeben. Finden sich die Interessen der Länder entsprechend wieder, hat sich das Vorgehen bewährt?
Ich halte so ein Vorgehen grundsätzlich für sinnvoll und im Falle der Krankenhausreform war es ein richtig guter Weg. Man muss viel Zeit vorher investieren, wir haben auch intensiv über die Eckpunkte diskutiert, dafür spart man später im Gesetzesverfahren umso mehr Zeit. Allerdings müssen wir jetzt nochmal genau hinschauen, wie das Gesetz letztendlich aussieht und was von den Bundesratsbeschlüssen übernommen wird. Da heißt es Obacht. Wir haben als Länder auch formuliert, dass wir das Gesetz für zustimmungspflichtig halten, das sieht der Bund leider anders.
Also wird es keine Interventionen seitens der Länder mehr geben (können)?
Wir müssen unser Augenmerk darauf legen, dass die Reform auch akzeptiert wird. Ansonsten werden die positiven Aspekte, die wir auf lange Sicht gemeinsam ausbauen wollen – wie zum Beispiel die stärkere Orientierung an der Qualität – nicht mehr ausreichend wahrgenommen. Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf des Gesetzes sind einige finanzielle Elemente aufgenommen worden, die einen starken Protest bei den Krankenhäusern ausgelöst haben. Hier müssen wir noch etwas zugunsten der Krankenhäuser nachbessern und werden an dieser Stelle auch politisch am Ball bleiben.
Eine zentrale Rolle in der Krankenhausreform spielt Qualität. Künftig soll sich die Planung stärker nach Qualität ausrichten. Wird das gelingen?
Wichtig ist, dass die Qualitätsstandards, die der Gemeinsame Bundesausschuss entwickeln soll, in den Ländern angepasst werden, denn man kann nicht alle Länder über einen Kamm scheren. Des Weiteren fangen wir nicht bei null an. Zum Beispiel existieren Register für Herzinfarkt sowie für Schlaganfall inklusive Qualitätsvorgaben und diese tragen eindeutig zur Verbesserung der Versorgung bei. Gut ist, dass durch diese Reform nun diese Ansätze an Rechtssicherheit und Verbindlichkeit gewinnen. Ich glaube, dass die Krankenhäuser den Ansatz der guten Qualität mittragen. Es darf nur eben nicht der falsche Eindruck entstehen, bislang sei qualitativ schlecht gearbeitet worden.
In Zukunft soll es bei unzureichender Qualität zu Schließungen von Abteilungen oder Krankenhäusern kommen. Dies den Bürgern und damit Wählern zu erklären, ist nicht unbedingt im Interesse des Kommunalpolitikers. Ziehen die Länder da wirklich mit?
Während meiner Amtszeit hatten wir in Rheinland-Pfalz Schließungen von Geburtsstationen, allerdings aufgrund fehlender Belegärzte und weniger Geburten. Meine Erfahrung ist, dass man dies schon vermittelt bekommt, wenn die Politik es gemeinsam mit dem Träger kommuniziert. Und im Grunde will ja der Patient eine gewisse Sicherheit beziehungsweise gute Qualität, und dies bekommt er in einem Krankenhaus mit entsprechender Schwerpunktsetzung. Insbesondere bei planbaren Operationen lässt sich das gut rechtfertigen. Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 79 Plankrankenhäuser an 101 Standorten, dazu kommen zwölf Vertragskrankenhäuser. Natürlich kann es zu Veränderungen kommen. Dann müssen wir aber gerade im ländlichen Raum zusehen, dass wir notwendige Leistungen auch vorhalten. Da kommt dann der Sicherstellungszuschlag ins Spiel, für kleinere Kliniken ist dieser eine ausschlaggebende Finanzspritze.
Bekommt man denn mit einer stärkeren Qualitätsorientierung das Mengenproblem in den Griff?
Ich sage mal so: Wenn ein Kennzeichen von Qualität die quantitative Erfahrung ist, könnte es auch kontraproduktiv sein. Denn wenn die Klinik eine gewisse Anzahl an Operationen vorweisen muss, dann könnte sie eben entsprechend operieren. Bereits jetzt wird ja schon in der Öffentlichkeit diskutiert, ob zum Beispiel die Knie-Operationen wirklich alle nötig sind. Darüber möchte ich mir kein Urteil bilden, aber man muss es diskutieren. Vieles läuft auch über Aufklärung, und da nehme ich sowohl die Träger und Einrichtungen als auch die Patienten selbst in die Verantwortung. Generell aber denke ich, mit Qualität alleine bekommen wir das Mengenproblem nicht in den Griff. Da müssen wir noch an anderen Stellschrauben drehen.
An welche zentralen Stellschrauben denken Sie da vor allen Dingen?
Entscheidend ist eine auskömmliche Finanzierung für Krankenhäuser, die nicht über Mehrleistungen verfügen beziehungsweise ihr Leistungspotenzial im Rahmen ihres Versorgungsauftrages eben einfach ausgeschöpft haben. Durch ein leistungsbezogenes Vergütungssystem soll nicht der Anreiz entstehen, mehr Leistungen erbringen zu müssen. Vielmehr unterstützen wir eine Begrenzung der Mengen auf das medizinisch Erforderliche, auch im Sinne der Patienten. Vielleicht müssen wir das stärker überprüfen; das Recht auf Einholung einer Zweitmeinung ist hier ein guter Ansatz. Hier haben wir auch unter den Ländern und mit dem Bund einen Konsens.
Für Umstrukturierungen wird ein Strukturfonds eingerichtet aus Mitteln des Gesundheitsfonds in der Höhe, in der die Länder den Fonds kofinanzieren, maximal 500 Millionen Euro von beiden Seiten. Er wird auch als Abwrackprämie bezeichnet.
Ich sehe das überhaupt nicht als „Abwrackprämie“, sondern als echte Chance. Wir können die Mittel für Umwidmungen nutzen, die Verzahnung ambulant und stationär verbessern, uns demografiefest aufstellen, und das alles mit dem Blick in die Zukunft. Durch diese zusätzlichen Mittel kann ich Strukturen schaffen, die dem Patienten am Ende mehr nützen. Wir wollen der Versorgungslandschaft neuen Schwung geben, was durch den Strukturfonds erleichtert wird.
Schließt dies eine bundesländerübergreifende Versorgung ein, etwa zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen?
Natürlich möchte ich so etwas auch künftig vorantreiben, es gibt ja bestimmte Träger, die so etwas durchaus schon machen. Aber da sind dicke Bretter zu bohren. Es gibt Strukturen, die seit Jahrzehnten so sind, wie sie sind. Und dann bundesländerübergreifend und sektorenübergreifend Neues aufzubauen, ist eine Herausforderung. Das muss gemeinschaftlich überwunden werden, gerade wenn Bedarf an Veränderungen besteht. Und dieser Bedarf ist da, da sind sich wohl alle einig.
Hält der Strukturfonds womöglich als Alibi für die Investitionsfinanzierung her?
In Rheinland-Pfalz haben wir im Investitionsprogramm 2015 mit Mitteln in Höhe von 114,2 Millionen Euro den Wert von 2014 halten können. Das war auch unser Ziel. Dann stehen am Horizont die 3,5 Milliarden Euro vom Bund für Investitionen in finanzschwache Städten und Gemeinden für die Jahre 2015 bis 2018, die für Krankenhäuser genutzt werden können. Wir müssen also alle Töpfe betrachten. Natürlich könnte man sich immer mehr wünschen. Aber für uns ist der Strukturfonds nicht der Anlass zu sagen, dann machen wir jetzt nichts mehr. Da sind wir uns der Verantwortung auch absolut bewusst.
Des Weiteren wird ein zweites Pflegestellenförderprogramm aufgelegt mit etwa 600 Millionen Euro. Die SPD fordert die doppelte Summe. Das erste Pflegestellenförderprogramm allerdings ist verpufft, es wurden Arztstellen finanziert. Besteht hier die gleiche Gefahr?
Die Verdoppelung der Gelder ist wichtig. Wenn jedes Krankenhaus nur 1,4 zusätzliche Stellen erhält, kann der Effekt tatsächlich erneut verpuffen. Diese Mittel müssen diesmal gezielt in die Pflege ans Bett und in eine Entlastung für die Pflegekräfte fließen. Das ist aber nur der erste Schritt, wir brauchen eine Strategie, wie der Pflegeberuf attraktiver wird. Derzeit liegen keine brauchbaren Vorschläge auf dem Tisch, deshalb fordern wir Länder eine Expertengruppe, die uns der Bundesgesundheitsminister auch mehrfach zugesagt hat.
Für die Krankenhausreform geht das Bundesgesundheitsministerium von Mehrausgaben in Höhe von 5,4 Milliarden Euro aus, die Krankenkassen rechnen mit acht Milliarden Euro. Wird es unterm Strich womöglich teurer?
Ich glaube, dass sich die Krankenhausreform langfristig bewähren und rechnen wird. Es ist jetzt erst mal eine kostspielige Umstellung, die sich aber mittel- und langfristig als lohnende Investition herausstellen wird. Wir müssen uns zukunftssicher aufstellen, und zwar am besten sofort. Die Kosten kommen so oder so, und dann bringe ich diese doch lieber jetzt auf, anstatt am Ende noch mehr zu zahlen.
Aber wie sollen diese Kosten finanziert werden?
Eine Patentlösung gibt es nicht, wie wir die Versorgung bei gleichbleibenden Kosten verbessern können. Die Kosten werden über die Krankenversicherung der Krankenhauspatienten sowie die öffentliche Hand getragen.
Bis die Reform wirkt, dauert es. Allein für die Planung nach Qualität sind fünf Jahre Vorbereitungszeit vorgesehen. Wie soll diese Zeit über- brückt werden?
Es ist ein Prozess, da kann man nicht einfach den Hebel umlegen. Doch die Richtung ist klar: Daher sollten wir schon jetzt den Blick der Qualität zuwenden, auch wenn es noch keine verbindlichen Festschreibungen gibt. Es wurde schon einiges auf den Weg gebracht, da müssen wir weitermachen. Das wollen die Länder auch und sie warten jetzt nicht auf die Bundesregierung.
Zum Schluss die Frage: Wie wird die Versorgungslandschaft in 20 Jahren aussehen?
Wir werden eine bedarfsdeckende, gute Versorgung haben, ergänzt durch Telemonitoring bei entsprechender Akzeptanz. Eine gute Primärversorgung wird ein Standortfaktor für die Kommunen sein. Deshalb haben wir zehn Zukunftswerkstätten in zehn Regionen von Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen, um ein Konzept zu entwickeln, wie auch in Zukunft insbesondere die hausärztliche Versorgung gesichert werden kann. Aufgrund der positiven Resonanz haben wir das Projekt gerade auf weitere zehn Regionen ausgedehnt. Ziel ist eine Versorgung, bei der man sagt, ich kann auch in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz gut leben. Und ich bin sicher, es wird lebenswert sein, weiterhin.







 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit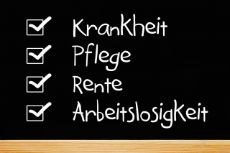 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


