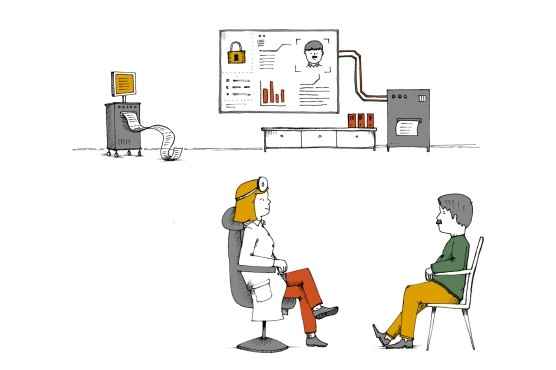
Fast zehn Jahre nach dem ersten Gesetz zur elektronischen Gesundheitskarte (eGK) schauen wir auf eine magere Erfolgsbilanz: Die Karten sind überwiegend ausgegeben, aber sie können einstweilen nicht mehr als die nicht digitalen Vorgänger. Es fehlt eine zuverlässige Infrastruktur, in der alle Leistungserbringer miteinander vernetzt sind, es fehlen verbindliche Standards und es fehlt der elektronische Zugang für die Patienten selbst.
Das E-Health-Gesetz will den Erfolg einer zentralen, sicheren, sektorübergreifenden und interoperablen Telematikinfrastruktur (TI) nun mit Anreizen und Strafszenarien erzwingen. Das ist im Interesse der Patienten zunächst einmal zu begrüßen. Der zögerliche Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien im deutschen Gesundheitswesen ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko und entmündigt Patienten, die an ihrer Versorgung aktiv mitwirken möchten. Gleichzeitig bestehen bezüglich der neuen Technologien große Unsicherheiten und Ängste sowohl bei den Leistungserbringern als auch bei den Versicherten. Das ursprüngliche Konzept für die eGK ist zwar im Namen von mehr Patientenautonomie (Datenhoheit) angepriesen, aber nicht partizipativ eingeführt worden. Weder gab es Bürgerforen, in denen Chancen und Risiken von den Bürgern selbst hätten erörtert werden können, noch gab es eine wissenschaftliche Befassung im Rahmen von Technikfolgenabschätzung. Im Resultat stehen auf allen Ebenen leidenschaftliche Gegner leidenschaftlichen Befürwortern unversöhnlich gegenüber und wir haben nach jahrelangem Gezerre nicht einmal einen Konsens darüber, wo tatsächlich Probleme liegen, die gelöst werden müssen.
Will man Chancen und Risiken angemessen abwägen, müssen die zugrunde liegenden Ängste geklärt und in einen rationalen Diskurs überführt werden. Ängste führen sonst in die Orientierungslosigkeit und in irrationale Verhaltensweisen nach Maßgabe des Fight-or-flight-Mechanismus. Langjährige Blockaden sind typisch für sogenannte disruptive Technologien, die neue Formen der Interaktion und Kommunikation hervorbringen und bestehende Routinen und Abläufe ersetzen. Beim Thema E-Health muss zudem gesehen werden, dass mobile Geräte sich vermutlich als Terminatortechnologie erweisen werden, um eine weitere martialische Vokabel zu zitieren, die man unterdessen häufiger liest. Ähnlich wie die Erfindung des Automobils zu einer schlagartigen Verbreitung von Verbrennungsmotoren geführt hat, sorgen Smartphones und Tablets dafür, dass die Digitalisierung rasant in jeden Winkel unseres Alltags dringt. Das Thema Datenschutz war und ist damit das Angstthema Nummer eins, allerdings ist gerade hier eine differenzierte Betrachtung ratsam. Bei der eGK ist das Sicherheitsniveau so hoch, dass kein pragmatischer Zugang der Versicherten zu ihren Daten vorgesehen worden ist. Bei einer Vielzahl der Applikationen, die für Smartphones angeboten werden bzw. auf den Geräten bereits vorinstalliert sind, gibt es demgegenüber vielfach gar keinen Datenschutz mehr. Den Nutzern ist das Maß ihres Ausgeliefertseins hierbei vielfach nicht bewusst.
Aufseiten der Patienten spielt eine weitere Angst eine große Rolle: Menschliche Zuwendung könnte durch Computer und Roboter ersetzt werden und ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient sei in Zukunft nicht mehr möglich. De facto kann ein breiter Einsatz moderner Kommunikationsmittel auch das Gegenteil bewirken, weil Dokumentationspflichten maschinenunterstützt im Hintergrund laufen und dem Arzt mehr Zeit für das persönliche Gespräch mit dem Patienten bleibt. Viele Ärzte fürchten, dass ihnen neue Investitionen und nicht angemessen honorierte Arbeit zugemutet werden, ohne dass ein echter Mehrwert für ihre alltägliche Arbeit entsteht. Auch hier kann Technik anders wahrgenommen werden, nämlich als Ermöglichungsbedingung für zeitsparenden kollegialen Austausch, der die Entscheidungsfindung erleichtert und Haftungsrisiken minimiert. Junge Ärzte wollen überwiegend nicht als Einzelkämpfer in einer Praxis arbeiten. Kollegialer Austausch ist für sie ein positiver Mehrwert. In der gegenwärtigen Diskussion ist eine neue und typisch deutsche Angst hinzugetreten: Wir fürchten jetzt auch wieder gegenüber anderen Ländern in der Entwicklung unserer Strukturen hinten zu liegen und den Anschluss unwiderruflich zu verpassen. Auch hier wäre es möglich, unaufgeregt aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Dem Thema E-Health wird zu Recht ein großes Potenzial zur Lösung hartleibiger Problemlagen im deutschen Gesundheitswesen zugetraut. Neben der Förderung von Patientenautonomie ist hier vor allem die Systemintegration zwischen Krankenhaus, ambulanter Versorgung und Pflege zu nennen. In unterversorgten Gebieten kann Telemedizin für Abhilfe bei fehlenden fachärztlichen Kompetenzen sorgen. Die Arbeitsorganisation lässt sich durch Kommunikationstechnik in allen Bereichen sehr schnell so verbessern, dass nicht nur die Versorgung qualitativ besser wird, sondern auch die Berufsausübung der vielen Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind. Eine sichere, interoperable Struktur ist für Patienten dann ein großer Nutzen, wenn dadurch das Sektorendenken und die mangelnde Kooperation zwischen den Leistungserbringern überwunden werden.
E-Health kann die Ermöglichungsbedingung sein für einen echten partnerschaftlichen Umgang zwischen Ärzten, nicht-ärztlichen Leistungserbringern und Patienten, die aktiv einbezogen werden wollen. Wenn wir weiter auf undifferenzierte Angstreflexe setzen, verspielen wir die Chance, die Gesundheitsversorgung mithilfe der neuen Technologien zu gestalten.







 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit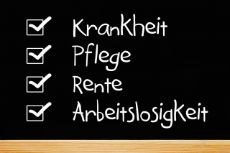 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


