Alle reden über die Digitalisierung des Gesundheitswesens – aber was genau meint das? Wo ist sie unproblematisch, wo sind Nutzennachweise angesagt, und welche Verheißungen gilt es besonders kritisch zu hinterfragen? Eine Kategorisierung.
Digitalisierung ist in aller Munde, und es lohnt ohne Zweifel, sich mit den sinnvollen Einsatzmöglichkeiten zu beschäftigen. Dazu bedarf es allerdings einer gewissen Differenzierung, um nicht über alle Aspekte gleichzeitig und damit letztlich über nichts zu diskutieren. Denn ein Nutzen für das System und die Betroffenen ist mal offensichtlich, mal unklar und dann wieder zu verneinen, jedenfalls derzeit.
In einer groben und sicher nicht völlig trennscharfen Unterteilung kann man zunächst den gesamten Bereich der Unterstützung von Verwaltungs- und Dokumentationsabläufen abgrenzen – vergleichbar mit der elektronischen Steuererklärung. Hier gibt es aus medizinischer Sicht wenige Anforderungen an Qualität und Nutzen. Dass auch dieser Bereich nicht ganz ohne Nachteile ist, weiß jeder, der schon einmal nachgefragt hat, warum ein Ablauf nicht funktioniert, und sich anhören durfte: „Seit wir auf EDV umgestellt haben …“
Kommunikation
Als zweiten Bereich kann man eine digital unterstützte (oder überhaupt erst ermöglichte) Kommunikation abgrenzen. Darunter fallen große Teile der Telematik und Telemedizin: die schnelle Übermittlung von Befunden, die Fernbeurteilung von Röntgenbildern oder dermatologischen Fotografien, die Unterstützung oder Supervision von Operationen „aus der Ferne“. In vielen Fällen geht es primär um logistische Unterstützung, was allerdings als Verkaufsargument nicht sehr zugkräftig ist. Deshalb werden auch gesundheitliche Vorteile für die Patienten geltend gemacht. Diese wiederum sind in einigen Fällen leicht zu erkennen, in anderen jedoch nicht selbstverständlich – und dann angemessen zu belegen. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat gerade einen Bericht zu telemedizinischen Anwendungen beim Monitoring bestimmter Formen einer Herzinsuffizienz vorgelegt. Die Analyse hat gezeigt, dass die Beleglage für gesundheitliche Vorteile – einen Nutzen – allenfalls dürftig genannt werden kann. Ein medizinischer (!) Nutzen ist selbst bei scheinbar banalen Dingen keineswegs selbstverständlich: Einen Allergiepass aus Papier schlägt der Notarzt bei dem Bewusstlosen auf und sieht sofort, was zu beachten ist. Für einen digitalen Pass auf einer Karte braucht er ein Lesegerät. Hoffentlich ist es das richtige, hoffentlich funktioniert es. Und für die auf dem Smartphone gespeicherten Allergien wird der Patient ihm die notwendigen Passwörter (Plural!) nicht mehr sagen können.
Apps
Der dritte Bereich sind sogenannte Apps, die entweder neue Informationen bereitstellen (wer führt schon täglich eine Strichliste über seine Schritte?) oder unmittelbar therapeutisch wirksam sein sollen wie eine App zur Tinnitus-Behandlung. Spätestens bei solchen Programmen ist klar, dass sie als medizinische Interventionen einzuordnen und nach den Regelungen des SGB V, der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) und den Methoden der evidenzbasierten Medizin zu bewerten sind. Erst wenn Erkenntnisse vorliegen, dass solche Methoden halten, was sie versprechen, und ihr Nutzen ihren Schaden (zum Beispiel auch das Verpassen anderer relevanter Behandlungen) überwiegt, sollten sie im Gesundheitssystem breit angewendet werden. In aller Regel können und sollten für solche Erkenntnisse die üblichen Studien – insbesondere randomisierte kontrollierte Studien – durchgeführt werden. Im Übrigen kann auch das bloße Bereitstellen neuer Informationen die Selbstwahrnehmung und das Verhalten verändern; das ist ja gerade die Intention vieler Apps. Auch in solchen Fällen sollten die Folgen bewertet werden.
Big Data
Der vierte Bereich, das Gewinnen neuer Erkenntnisse, wird unter dem Begriff Big Data subsumiert, der seinerseits beliebig unscharf ist. Grob gesagt sollen unterschiedlichste Datenquellen digital zusammengeführt werden, um aus riesigen, sich zudem zeitnah aktualisierenden Datenmengen Beziehungen oder Muster zu ermitteln. Diese sollen dann entweder – immerhin! – einer Überprüfung zugeführt oder aber direkt auf die Patienten „losgelassen“ werden (frei nach dem Motto: „Das Zeitalter der Kausalität ist vorbei“). Bisher hat Big Data keines seiner Versprechen eingelöst.
Neben vielen anderen Problemen wird hier ein Phänomen verdrängt, das aus der Nachrichtentechnik, dem medizinischen Screening, aber auch der Alltagserfahrung bekannt ist: Die ungezielte Suche nach Zusammenhängen verschlechtert das Verhältnis von falschen („Fehlalarmen“) zu richtigen Erkenntnissen drastisch. Heute schon nehme wir neueste Meldungen über das, was Kaffee angeblich Gutes oder Böses tut oder was Alzheimer „wirklich“ verhindert oder befördert, nur noch achselzuckend zur Kenntnis. Im Zeitalter von Big Data werden wir, so die Realität in die Nähe ihrer Versprechen kommt, mit „Erkenntnissen“ überschüttet werden und nicht mehr in der Lage sein, sie alle zu überprüfen, selbst wenn wir es wollten. Plakativ ausgedrückt: Wir werden unsere Zeit damit verbringen, den Müll wegzuräumen, statt uns an den wenigen neuen Rosenzüchtungen zu erfreuen.
Big Data bringt ein weiteres grundlegendes Problem mit sich, und damit kommen wir zum fünften Komplex: zur Unterstützung der einzelnen Entscheidung, also zum Bereich von Algorithmen, Maschinenlernen und künstlicher Intelligenz. Wenn tatsächlich auf aktuelle, sich in Echtzeit verändernde Daten zugegriffen wird, macht das Entscheidungen unüberprüfbar, weil sich die ihnen zugrunde liegenden Daten laufend verändern – und die Algorithmen möglicherweise auch. Das ist schon wissenschaftstheoretisch und -praktisch ein Problem, von der ethischen und der rechtlichen Dimension ganz zu schweigen. Der Deutsche Ethikrat hat in seiner ansonsten recht nebulösen Stellungnahme hierzu eine interessante Feststellung getroffen: „Der mögliche Nutzen von Big Data steht und fällt mit der Expertise und Integrität der Personen oder Institutionen, die Daten generieren, auswählen, verknüpfen und interpretieren.“ Mit anderen Worten: Wir sollen Personen oder Institutionen mehr Vertrauen schenken als Kontrollinstrumenten wie Regelungen, Prozessen und Methoden. Man darf dies getrost als einen Paradigmenwechsel bezeichnen, der sich einzig auf die Versprechen von Big Data gründet. Vertrauen statt Regularien: Das klingt nett, wird aber den Problemen, die bestimmte Aspekte der Digitalisierung aufwerfen, nicht gerecht. Dasselbe gilt auch für die Relativierung des Datenschutzes, die im Zusammenhang mit Big Data gerne eingefordert wird.
Unter Medizinern erzeugt der ironisch gemeinte Hinweis „viel hilft viel“ höchstens noch ein müdes Lächeln. Setzt man hinter das erste „viel“ aber „Information“, so sind Faszination und Erwartungen ungebrochen, kräftig beflügelt – und ausgenutzt – von denjenigen, die diese Daten haben oder liefern können. Dass „viel“ und „schnell“ allein die Versorgung verbessern, ist aber mehr als zweifelhaft.









 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit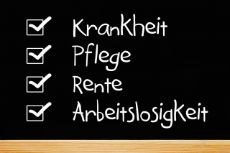 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


