
Die Haushaltsdebatte im Bundestag Anfang Juli 2018 nutzte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine Zwischenbilanz: Zufrieden referierte der CDU-Politiker über die gesetzgeberische Ausbeute seiner ersten Monate im Amt, schlug dabei den Bogen von Verbesserungen bei der Pflege über die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge bis zum freien Verkauf von HIV-Selbsttests. „Wenn Sie all das in den Blick nehmen, stellen Sie fest, dass in den ersten gut 100 Tagen im Bereich Gesundheit und Pflege viel Konkretes gelungen ist“, fasste er vor den Abgeordneten seine bisherige Arbeit zusammen.
Selbst Kritikern von Spahns gesundheitspolitischer Agenda dürfte es schwerfallen, ihm mangelnden Tatendrang vorzuwerfen. Auch an seinem Fachwissen bestehen keine Zweifel, schließlich kann der Münsterländer auf die jahrelange Erfahrung als gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion zurückgreifen. Einige Vorhaben des Ministers sind allerdings mit ungedeckten Schecks unterlegt – finanziell wie politisch. Als erstes Projekt brachte Spahn das Versichertenentlastungsgesetz durch das Kabinett. Mit der Rückkehr zur Beitragsparität sollen die Bürger ab 2019 um 6,9 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Darüber hinaus will der Minister Kassen mit mehr als einer Monatsausgabe auf der hohen Kante ab 2020 dazu verpflichten, die Zusatzbeiträge über ein Abschmelzen ihrer Rücklagen zu senken.
Spahn musste nach Kritik von Gesundheitspolitikern aus der Koalition aber ein wichtiges Zugeständnis machen: Die zusätzlichen Beitragssenkungen kommen nur dann, wenn er den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) reformiert und damit die Schieflage bei den Finanzzuweisungen an die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds angeht. Wie kompliziert und umstritten die Reform wird, zeigt das jüngst veröffentlichte Gutachten zu den regionalen Verteilungswirkungen des RSA: Anstatt Klarheit zu schaffen, befeuerte es den Streit zwischen den Krankenkassen bei diesem Thema weiter. Spahn schlagen auch Warnungen des GKV-Spitzenverbandes entgegen, dass die Finanzlage der 110 gesetzlichen Kassen keineswegs so rosig ist, wie es die Rücklagen vermuten lassen. Die Verbandsvorsitzende Doris Pfeiffer weist darauf hin, dass die Reserven von insgesamt fast 20 Milliarden Euro nur einer Monatsausgabe im gesetzlichen Krankenversicherungssystem entsprechen. Dazu kommt, dass Spahn die Krankenkassen zunehmend zur Finanzierung der Pflege heranziehen will. In einem Sofortprogramm hat der Minister 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege versprochen. Weil diese Stellen als „medizinische Behandlungspflege" deklariert werden sollen, muss die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) die Finanzierung übernehmen. Daneben sollen die Kassen auch die Kosten für jede zusätzliche Pflegestelle am Bett in den Krankenhäusern tragen. Noch völlig unklar ist, welche Summen am Ende bei der sogenannten Konzertierten Aktion Pflege fällig werden. Gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und der für Senioren zuständigen Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) lässt Spahn in dem auf ein Jahr angelegten Prozess Vorschläge erarbeiten, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Einig ist sich die große Koalition schon einmal darin, dass die Bezahlung durch flächendeckende Tariflöhne in der Branche steigen soll.
Vorsorglich hat Spahn bereits eine Anhebung des Pflegebeitrags um 0,5 Punkte zum 1. Januar 2019 angekündigt – wobei die Mehreinnahmen wohl alleine dafür benötigt werden, die teurer als geplant ausgefallene Pflegereform der vergangenen Legislaturperiode zu finanzieren. Den Unmut der Beitragszahler fürchtet der Minister nicht. Wiederholt verwies er darauf, dass die Bereitschaft der Bevölkerung in Umfragen groß sei, mehr Geld für die Pflege auszugeben. Sein drittes großes Gesetzesvorhaben brachte Spahn kurz vor der Sommerpause in die Ressortabstimmung, ein umfangreiches Paket zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. Im Kern steht das Aufregerthema der unterschiedlichen Wartezeiten von Kassen- und Privatpatienten. Damit gesetzlich Versicherte schneller einen Arzttermin bekommen, sollen die Terminservicestellen zu Rund-um-die-Uhr-Diensten ausgebaut und die Zahl der Mindestsprechstunden von 20 auf 25 Stunden pro Woche angehoben werden. Bestimmte Arztgruppen müssen künftig fünf offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten. Während die Kassenärzte durch die geplante Neuregelung ein Chaos in den Wartezimmern und bürokratischen Aufwand befürchten, läuft der GKV-Spitzenverband gegen die Mehrausgaben Sturm. Die Ärzte sollen für die Aufnahme von Neupatienten besser und außerhalb der Budgets vergütet werden. 500 bis 600 Millionen Euro pro Jahr könnte das die Kassen zusätzlich kosten, schätzt das Gesundheitsministerium.
Das Gesetz verpflichtet die Krankenkassen auch, ihren Versicherten bis spätestens Anfang 2021 eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Außerdem schafft es die Möglichkeit, dass Patienten auf ihre Gesundheitsdaten künftig per Tablet oder Smartphone zugreifen können. Spahn hat die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu einem Megathema seiner Amtszeit erklärt und eine eigene Abteilung für den Bereich geschaffen. Deutschland soll nach den jahrelangen Querelen um die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und den Aufbau eines sicheren Gesundheitsdatennetzes endlich den Anschluss an die Zukunft finden. Nach der Sommerpause dürfte Spahn damit beschäftigt sein, die ersten Gesetzesvorhaben durch den Bundestag zu bekommen, damit sie Anfang 2019 in Kraft treten können. Für Auseinandersetzungen scheint er gerüstet: Der Minister hat sich in den ersten Monaten mit offenem Visier auf das Schlachtfeld der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen gewagt und den Konflikt mit mächtigen Interessengruppen nicht gescheut. Auf dem Ärztetag in Erfurt im Mai ließ er grummelnde Mediziner wissen, dass Kassenpatienten auch deshalb oft zu lange auf einen Facharzttermin warten müssten, weil eine Minderheit von Ärzten ihr Sprechstundenpotenzial nicht ausschöpfe.
Anders als seine jüngsten Vorgänger im Gesundheitsministerium gilt Spahn als Kandidat für noch höhere politische Weihen. Die konservative Nachwuchshoffnung profilierte sich in den vergangenen Jahren als Gegenspieler von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), vor allem in der Flüchtlingspolitik. Merkel hatte ursprünglich gar keinen Ministerposten für Spahn vorgesehen und holte ihren Kritiker nur unter innerparteilichem Druck ins Kabinett. Als müsste er seine Unabhängigkeit unter Beweis stellen, zettelte der 38-Jährige in den ersten Wochen seiner Amtszeit kontroverse Debatten über die Armut von Hartz IV-Empfängern und die Sicherheitslage in deutschen Städten an. Seitdem achtet Spahn allerdings peinlich genau darauf, sich nur im Zuständigkeitsbereich seines Ressorts zu bewegen. Dort hat er ja auch genug zu tun.










 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit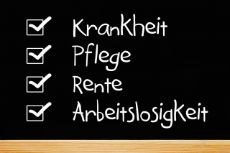 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


