
Erwin Rüddel (CDU/CSU), Vorsitzender Gesundheitsausschuss
Wenn in der Gesundheitspolitik Gesetze und Reformen anstehen, spielt der Ausschuss für Gesundheit eine zentrale Rolle. Die Ausschussmitglieder diskutieren über entsprechende Vorlagen, holen Stellungnahmen ein und führen Anhörungen durch, bevor der Ausschuss seine Beschlussempfehlungen an den Bundestag übermittelt. In der aktuellen Legislaturperiode besteht der Ausschuss für Gesundheit aus 41 Mitgliedern. Das Gremium tagt in jeder Sitzungswoche. Erwin Rüddel ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses (CDU/CSU). Er ist für die Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Ausschusssitzungen verantwortlich. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht er über die Arbeit des Ausschusses, über seine Funktion als Gesundheitspolitiker auf der einen und Wahlkreisabgeordneter auf der anderen Seite sowie über notwendige Veränderungen in der Versorgung.
Sie sind seit mehr als drei Jahrzehnten politisch aktiv, seit 2009 Bundestagsabgeordneter für Ihren Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen, aktuell Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. In welcher Rolle fühlen Sie sich am wohlsten?
Auf der Bundesebene werde ich in erster Linie als Gesundheitspolitiker angesehen. Wenn ich in meiner Heimat im Westerwald unterwegs bin, bin ich der Wahlkreisabgeordnete, für viele der Erwin, der in Berlin ist. Diese zwei Seiten zu repräsentieren, ist schön. Aber gerade jetzt als Ausschussvorsitzender fühle ich mich auf der Bundesebene besonders wohl. Wobei ich ja eigentlich damals in den Ausschuss für Verkehr wollte. In meinem Wahlkreis war Verkehr das maßgebliche Thema, neben dem Thema Breitbandausbau. Inzwischen aber hat Gesundheit an Stellenwert richtig zugenommen. Und ich muss sagen, dass ich mir derzeit keinen spannenderen Ausschuss als den für Gesundheit vorstellen kann.
Was sind Ihre Aufgaben als Ausschussvorsitzender?
Zum einen sehe ich mich in einer moderierenden und vermittelnden Rolle. Ich glaube, dass wir im Ausschuss ein ordentliches Miteinander haben über alle Fraktionen hinweg, was auch daran liegt, dass man den Kollegen gegenüber den nötigen Respekt zollt. Natürlich kommt es auch mal zu strittigen Punkten, da ist die Frage, wie ich als Vorsitzender diese Auseinandersetzung steuere. Zum anderen habe ich als Ausschussvorsitzender schon gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, da ich sehr früh in Entscheidungsprozesse eingebunden bin. Zum Beispiel gibt es in jeder Sitzungswoche eine Koordinierungsrunde im Ministerium mit einem überschaubaren Kreis an Personen, unter anderen auch mit dem Bundesgesundheitsminister, dementsprechend gut informiert bin ich darüber, was auf der Agenda steht und kann diese Dinge in die Ausschussarbeit einpflegen. Die Möglichkeiten der Einflussnahme und Mitgestaltung sind schon deutlich höher, als wenn ich einfaches Mitglied im Ausschuss wäre.
Wo brauchen wir neue Ideen im Gesundheitswesen?
In erster Linie brauchen wir neue Versorgungsstrukturen, und zwar so schnell wie möglich. Ich bin ganz sicher, dass das nächste Jahr das Jahr der Veränderungen wird. Wenn wir meinen, wir können das Gesundheitssystem so beibehalten, wie es ist, werden wir in den nächsten fünf Jahren eine dramatische Entwicklung erleben. Schauen wir auf die Verteilung der Ärzte: In meinem Wahlkreis, der eher ländlich geprägt ist, gibt es einzelne Regionen, in denen kein Hausarzt mehr tätig ist, und in einer etwas größeren Region mit knapp 20.000 Einwohner gibt es noch drei Hausärzte, von denen der jüngste 62 Jahre alt ist. Alle drei Ärzte finden keinen Nachfolger. Ähnlich sieht es in Randbereichen aus. Zugleich stelle ich fest, dass Fachärzte dort zu finden sind, wo auch Krankenhäuser sind. Meine Vision für die Zukunft ist daher, dass die Sektorengrenzen immer weiter wegfallen und wir in zwölf bis 15 Jahren eine medizinische Versorgung haben, in der Haus und andere Fachärzte in der Umgebung erreichbar sind und zusammenarbeiten.
Wie wollen Sie die Ärzte dazu bewegen, sich in der Fläche niederzulassen?
Einerseits brauchen wir Anreize. In meiner Heimatverbandsgemeinde mit 23.000 Einwohnern wurde der Beschluss gefasst, dass jeder Arzt 100.000 Euro bekommt, der dort eine Praxis übernimmt. Da haben einige zugeschlagen, weil so schon mal die Kosten für Ausstattung und Investitionen abgedeckt sind. Aber die Summe ist natürlich auch eine Hausnummer, die kann sich nicht jede Gemeinde leisten. In Rheinland-Pfalz wurden 15.000 Euro für eine Niederlassung angeboten, das hat keiner abgerufen. Wir brauchen also eine gewisse Flexibilität, was Anreize angeht. Andererseits zeigen Untersuchungen, dass viele Medizinstudierende erklären, später nicht einer freiberuflich geführten Praxis tätig sein zu wollen, sondern ein Angestelltenverhältnis anstreben. Hier kommen die Medizinischen Versorgungszentren ins Spiel. Ich glaube, die Versorgung der Zukunft wird so aussehen, dass wir Zentren haben, an denen Ärzte ihre Leistungen konzentriert anbieten. Ob sie dann voll angestellt oder teilweise in einer eigenen Praxis tätig sind, lässt sich flexibel regeln. So besteht die Möglichkeit, dass der Patient das Zentrum aufsucht oder aber der Arzt zu dem Patienten nach Hause kommt, was gerade für ältere Menschen in der Fläche interessant sein wird.
Wie breit sollten die Medizinischen Versorgungszentren aufgestellt sein?
Im Mittelpunkt stehen die Ärzte verschiedener Fachrichtungen. Aber wenn es beispielsweise um Hausbesuche geht, können das auch Gemeinde- oder Krankenschwestern oder auch Arzthelferinnen übernehmen, wenn sie entsprechend geschult und mit der notwendigen Technik ausgestattet sind. Delegation spielt in diesem Veränderungsprozess eine große Rolle. Genauso könnte auch eine Apotheke Teil der Versorgung sein und mehr Leistungen übernehmen, beispielsweise das Impfen. Heute würde ein Arzt vielleicht noch sagen, impfen kann und darf ein Apotheker nicht. Aber wenn sich die Strukturen dahingehend verschieben, dass Ärzte überwiegend angestellt sind, dann wird es diese Auseinandersetzung in dem Maße nicht mehr geben, weil es nicht mehr um Abrechnung und damit um wirtschaftliche Existenz geht. Insgesamt muss es mehr Flexibilität geben, wer was wann und wo macht. Ich denke, es sollten viele Freiheiten geschaffen werden, sodass sich jede Region mit ihren Besonderheiten entwickeln kann. Aber wir haben auch gelernt, dass man stringenter einfordern muss, dass diese Möglichkeiten vor Ort auch genutzt werden.
War das in der Vergangenheit nicht der Fall?
In der vorletzten Legislaturperiode stand das Wort „kann“ im Mittelpunkt, also es gab zwar gesetzliche Möglichkeiten, die aber kaum genutzt wurden. In der letzten Legislaturperiode haben wir „kann“ durch „soll“ ersetzt, weil wir festgestellt haben, dass es mehr Druck etwa in der Selbstverwaltung und bei den Ländern braucht, um Veränderungen zu bewirken. Beispielsweise hatten wir die Möglichkeit geschaffen, dass die Bedarfsplanung bzw. die Versorgungsbezirke kleinteiliger ausgestaltet werden. In vielen Bundesländern wurde das Instrument aber nicht genutzt, die Kassenärztlichen Vereinigungen zu zwingen, bedarfsgerechter zu planen. Oder nehmen wir das Beispiel Krankenhausplanung, was ja Aufgabe der Länder ist: Da mussten wir jetzt ein Gesetz einführen, um der Pflege im Krankenhausbereich zu ihrem Recht zu verhelfen. Denn die Krankenhäuser waren aufgrund der schlechten Ausfinanzierung der Länder gezwungen, Geld in Immobilien und Einrichtungen zu stecken, das eigentlich für die Pflege bestimmt war. An vielen Ecken und Enden stelle ich fest, dass die Länder zwar in unterschiedlicher Ausprägung, aber doch immer wieder Dinge nicht in gewünschter Stringenz umsetzen.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
Digitalisierung und Vernetzung von Ärzten und spezialisiertem Wissen werden eine ganz andere Dimension bekommen, auch in der Pflege. Diese Entwicklung hin zu Telemedizin und ähnlichem ist auch gar nicht mehr aufzuhalten. Wir sind im Grunde mindestens zehn Jahre zu spät dran, das hätte man viel früher angehen müssen. Die Frage ist jetzt letztendlich, wie wir die Start-ups, die Apps und die teilweise bereits vorhandene Vernetzung in eine qualitätsgesteuerte Gesundheitsversorgung integrieren. Mit jeder Woche, die wir länger warten, breitet sich immer stärker eine Parallelwelt aus, auf die wir keinen Einfluss haben, und diese Parallelwelt müssen wir versuchen einzufangen. Wenn uns das gelingt, bin ich der festen Überzeugung, dass wir durch Digitalisierung mehr Fortschritt und Qualität in der Versorgung erreichen. Die Sorge ist immer, dass die Technik den Arzt oder Pfleger ersetzt. Dabei schafft sie im Gegenteil Möglichkeiten für mehr Zeit und Zuwendung für den Patienten. Diese Chancen muss man den Menschen vernünftig erklären.
Wie vermitteln Sie den Bürgern vor Ort diese Veränderungen?
Zum Teil gibt es ja schon Veränderungen und bislang sehe ich da keinen Protest in der Bevölkerung. Natürlich gibt es Probleme, etwa was Anfahrtswege betrifft. Da müsste dann beispielsweise der Bürgermeister ehrenamtliche Fahrdienste organisieren, was auch schon gut läuft. Regionen können voneinander lernen, da muss nicht überall etwas ganz Neues entstehen. Meiner Erfahrung nach ist es nicht der Patient, der als erster aufschreit, wenn es um Veränderungen geht, sondern die Kommunalpolitik. Der Bürgermeister, der Landrat, die Politiker vor Ort haben Sorge um das Krankenhaus, die Arztpraxen, Apotheken. Meine Wahrnehmung ist die, dass der Reflex in der Kommunalpolitik der ist, alles beim Alten zu lassen. Aber es kann so nicht erhalten bleiben, und das sage ich auch immer zu Hause in meinem Wahlkreis: Es kommt alles anders, wir müssen uns auf eine komplett andere Art der Versorgung einstellen, dagegen können wir uns nicht wehren, der demografische Wandel und das Streben nach besserer Qualität werden für Veränderungen sorgen. Aber ich sage auch, dass diese neue Versorgung besser wird.
Wie soll diese neue Versorgung finanziert werden?
Man muss da sicherlich unterscheiden zwischen Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Bei der Pflegeversicherung haben wir durch die Gesetzgebung in der letzten Legislaturperiode eine starke Leistungsdynamik ausgelöst. Wir haben den Kreis der Leistungsempfänger ebenso wie den Umfang der Leistungen ausgeweitet. Dadurch gab es eine Kostenexplosion, die gewollt war. Allerdings sind daraus nun auch Versorgungsstrukturen entstanden, die besonders teuer sind. Sie haben quasi stationären Charakter, indem die verbesserten ambulanten Möglichkeiten von findigen Leistungserbringern voll abgeschöpft werden. Das sollte verhindert werden. Dafür brauchen wir neue Versorgungsstrukturen, mit denen man die Überwindung von Sektorengrenzen im Pflegebereich hinbekommt. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden wir auch in Zukunft einen erhöhten Finanzierungsbedarf haben. Wir können aber nicht jedes Jahr die Pflegeversicherungsbeiträge um 0,3 oder 0,5 Prozent erhöhen. Zudem ist die gute Bezahlung von Pflegekräften meiner Meinung nach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das kann nicht allein von der Pflegeversicherung oder den Pflegebedürftigen selbst getragen werden, sondern wir müssen auch über einen Steuerzuschuss sprechen.
Und in der Krankenversicherung?
Da sehe ich den Druck im Moment nicht ganz so stark. Die Krankenkassen verfügen noch über erhebliche Überschüsse, wenn auch unterschiedlich verteilt. Der Bundesgesundheitsminister möchte so schnell wie möglich eine Entlastung für die Beitragszahler erreichen. Und wir wollen die Kassen verpflichten, Rücklagen abzubauen. Aber das geht erst, sobald eine gewisse Gerechtigkeit unter den Kassen entstanden ist im Hinblick darauf, wie die Rücklagen bzw. Überschüsse zustande gekommen sind. Wir beabsichtigen ja eine Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) und diese Reform muss vor der Beitragsentlastung entschieden sein. Diese soll Ende 2019 kommen, wir müssen praktisch in den nächsten zwölf Monaten Entscheidungen treffen, was für eine solch komplizierte Reformaufgabe anspruchsvoll ist. Darüber hinaus müssen wir uns meiner Meinung nach auch dringend mit der Frage der Aufsichtspraxis beschäftigen.
Was schwebt Ihnen da vor?
Derzeit ist es so, dass die Ersatzkassen, Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen unter Bundesaufsicht stehen, die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) unter der Aufsicht der Länder. Wenn es nach mir ginge, würde ich eine gemeinsame bzw. einheitliche Kassenaufsicht auf die Beine stellen. Ich stelle immer wieder fest, dass die Länder und AOK oft kreative, flexible Lösungen finden, die den Ersatzkassen, Betriebs- und Innungskrankenkassen nicht möglich sind, weil das Bundesversicherungsamt als deren zuständige Aufsichtsbehörde stringenter kontrolliert und prüft. Das ist nicht gerecht. Wenn wir eine Reform des RSA angehen, brauchen wir auch Gerechtigkeit an anderer Stelle.
Machen da die Länder mit?
Die Länder werden sicherlich ungern Kompetenzen abgeben, da werden noch dicke Bretter gebohrt werden müssen.
Wann ist mit einem Gesetzentwurf zum RSA zu rechnen?
Das ist schwer zu sagen. Man hört immer wieder, dass es nur ganz wenige Leute gibt, die den RSA wirklich verstehen. Das wird spannend. Aber ich bin überzeugt davon, dass es übereinstimmend, zumindest bei uns in der Fraktion, aber auch in der Koalition und darüber hinaus, die Haltung geben wird, dass wir Strukturen schaffen müssen, die die Ersatzkassen und Betriebs- sowie Innungskrankenkassen in die gleiche Lage versetzen wie die Ortskrankenkassen. Oder eben andersrum, dass die Ortskrankenkassen unter den gleichen Rahmenbedingungen agieren sollen und müssen wie die anderen Kassen.


 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit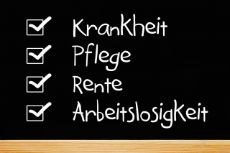 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


