Prof. Dr. Claudia Schmidtke ist Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten und engagiert sich für deren Rechte, Bedarfe und Wünsche. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht sie über Herausforderungen im Gesundheitssystem, über den Umgang mit Fehlern sowie über die Bedeutung von Aufklärung und Transparenz.

ersatzkasse magazin: Sie sind selbst Ärztin, haben lange als Herzchirurgin gearbeitet, inwiefern hilft Ihnen diese Erfahrung in Ihrer Rolle als Patientenbeauftragte?
Claudia Schmidtke: Als Herzchirurgin und auch als Gesundheitsökonomin kenne ich mich mit den Strukturen unseres Gesundheitswesens und insbesondere des Krankenhausbetriebes bestens aus. Auf dieses Wissen kann ich als Patientenbeauftragte zurückgreifen. Wichtiger ist jedoch, dass ich selbst Patientinnen und Patienten behandelt habe. Mein ärztliches Selbstverständnis ist es, hinter der Erkrankung immer den betroffenen Menschen und auch seine Angehörigen individuell zu betrachten, ihre Bedürfnisse bzw. Sorgen ernst zu nehmen und offen und ehrlich mit ihnen zu kommunizieren. Das ist auch mein Anspruch als Patientenbeauftragte.
Welche Bereiche der Gesundheitsversorgung sind Ihnen besonders wichtig, wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Was wünschen Sie sich selbst als Patientin?
Mein Wunsch wäre eine noch bessere und strukturiertere Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Deutschland die häufigste Todesursache im Erwachsenenalter sind. Mit einer Vielzahl von Expertinnen und Experten arbeite ich an einer Nationalen Herz-Kreislauf-Strategie. Zudem erhoffe ich mir, dass in unserem Gesundheitssystem zügig die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung zur Anwendung kommen, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Dabei geht es mir insbesondere um rechtliche Rahmenbedingungen, die eine ausgewogene Balance zwischen dem unabdingbaren Datenschutz und der Datensicherheit sowie einer sinnvollen Datennutzung zum Nutzen der Patientinnen und Patienten – zum Beispiel für die elektronische Patientenakte oder die medizinische Forschung – ermöglichen.
Inwiefern hat sich die Rolle der Patientinnen und Patienten in der Gesundheitsversorgung in den letzten Jahrzehnten gewandelt?
Ganz klar können wir hier einen positiven Wandel beobachten: Patientinnen und Patienten sind heutzutage sehr viel besser informiert und setzen sich selbständig mit Krankheitsbildern und Behandlungen auseinander. Das liegt sicher auch an den Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter mit sich bringt. Sie nehmen damit eine neue, selbstbestimmte Rolle im Arzt-Patienten-Verhältnis ein. Sie werden von passiven Zuschauern zu informierten Managern ihrer Gesundheit. Sie erwarten eine partizipative Kommunikationskultur mit ihren Behandelnden und wollen die Entscheidungen über die eigene Gesundheit und Therapie gemeinsam mit den Behandelnden treffen. Diese Entwicklung ist uneingeschränkt zu begrüßen und muss weiter unterstützt werden.
Behandlungsfehler sind ein zentraler Baustein des Patientenrechtegesetzes. Jedoch befinden sich Patienteninnen und Patienten nach wie vor in einer schwachen Position, wenn es um die Beweislast geht. Wie lässt sich das modifizieren?
Nach geltendem Arzthaftungsrecht müssen Patientinnen und Patienten zweifelsfrei nachweisen, dass ein Behandlungsfehler Ursache für einen erlittenen Gesundheitsschaden ist. In der Medizin ist dieser Beweis aber kaum zu führen. Denn die Komplexität des menschlichen Körpers führt dazu, dass Kausalzusammenhänge objektiv schwieriger nachzuweisen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass Patienten, bei denen ein Behandlungsfehler in Rede steht, in aller Regel nicht gesund in eine Behandlung gehen, sondern unter Umständen sogar unter mehreren Erkrankungen leiden, die ebenfalls für einen Gesundheitsschaden ursächlich sein könnten.
Trotz der mit dem Patientenrechtegesetz festgeschriebenen Beweiserleichterungen gelingt Patienten der geforderte Nachweis in der Praxis oft nicht. Es gibt daher seit Längerem eine Diskussion darüber, die Regelungen dahingehend zu verändern, dass es für den Nachweis der Kausalität ausreichen soll, dass der Zusammenhang zwischen Behandlungsfehler und Schaden überwiegend wahrscheinlich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Absenkung des Beweismaßes zu einer Stärkung der Rechte der betroffenen Patientinnen und Patienten führt.
Wie kann sichergestellt werden, dass von Behandlungsfehlern betroffene Patientinnen und Patienten angemessen entschädigt werden? Die Krankenkassen fordern, dass Ärzte und Medizinproduktehersteller eine Haftpflichtversicherung mit angemessener Versicherungssumme abschließen müssen.
Mir ist zunächst wichtig klarzustellen, dass Ärztinnen und Ärzte bereits heute verpflichtet sind, sich hinreichend gegen Haftpflichtansprüche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu versichern. Entsprechende Vorschriften finden sich in den jeweiligen Heilberufe- und Kammergesetzen der Länder, die in der Regel zusätzlich auf die Berufsordnung verweisen.
In der überwiegenden Anzahl der Länder ist zudem die Kammer als sogenannte zuständige Stelle vorgesehen, der ein Versicherungsunternehmen die Beendigung einer Berufshaftpflichtversicherung zu melden hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Meldeverfahren eine wichtige Maßnahme ist. Alle Länder sollten daher eine solche Regelung in ihre Landesgesetze übernehmen. Eine sinnvolle Ergänzung wäre es aus meiner Sicht, den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung als zusätzliche Zulassungsvoraussetzung für Vertragsärzte einzuführen. Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass das Bundesgesundheitsministerium derzeit an einer dahingehenden Änderung arbeitet.
Diskutiert wird darüber hinaus auch ein Patientenentschädigungsfonds.
Im Koalitionsvertrag ist die Prüfung eines Patientenentschädigungsfonds vereinbart. Der gute Wille, mit einem Fonds einen Ausgleich außerhalb des Haftungsrechts zu schaffen und so im Schadensfall eine Befriedung der Konfliktsituation zwischen Behandelndem und Patienten zu erreichen, birgt jedoch auch Risiken: Wenn ein anderer für Schäden zahlen muss, wird die erforderliche Sorgfalt möglicherweise außer Acht gelassen. Hierdurch könnten die Anforderungen an die Fehlervermeidung stückweise aufgeweicht werden. Außerdem könnten Patienten bevorzugt den Fonds in Anspruch nehmen, wodurch die Arzthaftung eingeschränkt würde. Darüber hinaus sind die Finanzierungsmöglichkeiten eines Fonds bisher unklar. Sie müssten konsequent an der Zielsetzung ausgerichtet werden.
Brauchen wir grundsätzlich eine neue Fehlerkultur in der Medizin und in der Pflege, generell einen offeneren Umgang mit Fehlern?
Ich plädiere für eine Sicherheitskultur auf allen Ebenen, die die Patientensicherheit in den Mittelpunkt stellt. Hier hat sich in den letzten Jahren auch schon sehr viel getan, auch dank des Aktionsbündnisses Patientensicherheit e.V. (APS).
Als Ärztin bin ich davon überzeugt, dass ein offener Umgang mit Fehlern zu einer Sensibilisierung für sicherheitsrelevante Aspekte führt und die Risikoprävention stärkt. Zudem erwarten Patientinnen und Patienten zu Recht, dass mit ihnen ehrlich und transparent kommuniziert wird, sollte es zu einem Fehler gekommen sein.
Eine gute und im besten Fall empathische Kommunikation mit den Betroffenen auf Augenhöhe kann dazu beitragen, Ängste und Unsicherheiten in einer für sie ohnehin belastenden Ausnahmesituation zu lindern. Und auch für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte ist ein professioneller und aufrichtiger Umgang mit Patientinnen und Patienten kein Risiko: Weder die Erläuterung von Tatsachen und medizinischen Sachverhalten noch der Ausdruck von Bedauern und Mitgefühl sind im Schadensfall aus rechtlicher Sicht als Schuldeingeständnis oder als Anerkenntnis einer Haftungsübernahme zu werten.
Eine gemeinsame Offensive für die Sicherheit in der Gesundheitsversorgung fordern das APS und der vdek unter anderem im Zuge des 2018 erschienenen Weißbuches Patientensicherheit. Ein Element zur Umsetzung ist die Etablierung einer Beauftragten oder eines Beauftragten für Patientensicherheit in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Was halten Sie davon?
Sollten sich Einrichtungen des Gesundheitswesens dafür entscheiden, eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Patientensicherheit einzusetzen, um so zu einer Verbesserung der Patientensicherheit beizutragen, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte.
Teilweise versuchen noch immer Ärzte, ihren Patienten sogenannte Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) aufzudrängen. Wie lassen sich Patienten vor unnötigen Behandlungen schützen?
Dem kann durch eine noch bessere Aufklärung und Information der Patientinnen und Patienten über ihre Rechte begegnet werden. Es gibt durchaus IGeL, die in bestimmten Situationen im Einzelfall sinnvoll und empfehlenswert sein können - ohne dass diese Leistungen tatsächlich medizinisch notwendig sind.
Wesentlich ist aber, dass Patientinnen und Patienten sich bewusst sind, dass sie allein darüber entscheiden, ob sie die Leistung in Anspruch nehmen wollen. Diese Entscheidung müssen sie in Ruhe und auf der Grundlage von Fakten treffen. Ärztinnen und Ärzte sind daher unter anderem verpflichtet, vorab über mögliche Risiken und Nutzen, eventuelle alternative Behandlungen und die Kosten von IGeL zu informieren. Eines ist ganz klar: Patientinnen und Patienten dürfen nicht dazu gedrängt werden, IGeL in Anspruch zu nehmen. Es ist auch ausdrücklich unzulässig, eine medizinisch notwendige Behandlung oder Untersuchung davon abhängig zu machen, dass IGeL in Anspruch genommen werden.
Ich empfehle Patientinnen und Patienten, die sich bei IGeL unsicher sind, sich die Zeit zu nehmen, die sie tatsächlich brauchen, um sich gut zu informieren. Die meisten Ärzte kommen ihren Pflichten gewissenhaft nach und respektieren die freie Willensbildung der Patienten. Patientinnen und Patienten, die das Gefühl haben, dass sich ihre behandelnde Ärztin oder ihr Arzt nicht angemessen verhalten haben, sollten dies in jedem Fall der für ihr Bundesland zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung melden. Diese prüft dann den Fall.
Vor 20 Jahren wurde die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) gegründet, zunächst als Modellprojekt, heute als fester Bestandteil der Gesundheitsversorgung. Welche Bedeutung schreiben Sie ihr und ähnlichen Beratungsstellen zu?
Trotz der von mir schon angesprochenen Tatsache, dass sich Menschen auch dank des digitalen Wandels immer mehr mit Gesundheitsinformationen auseinandersetzen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich viele in gesundheitlichen Fragen nicht gut zurecht finden. Das liegt zum einem daran, dass unser Gesundheitssystem immer komplexer wird: Die Fülle der Versorgungsmöglichkeiten richtig zu nutzen, ist eine Herausforderung. Zudem erfolgt die Nutzung des Internets als Informationsmedium überwiegend durch jüngere Personen, sodass ältere Menschen oder besonders vulnerable Zielgruppen kaum erreicht werden. Nicht zu vergessen, dass viele Informationen im Internet ungefiltert und ohne jede Qualitätssicherung zu Verfügung stehen.
Insbesondere das qualifizierte, neutrale, unabhängige und kostenfreie Beratungsangebot der UPD ist daher ein wesentlicher Baustein, wenn es darum geht, Patientinnen und Patienten verlässliche Informationen zu sozialrechtlichen, aber auch medizinischen Fragen anzubieten, und es ihnen damit zu ermöglichen, sich selbstbestimmt durch unser Gesundheitssystem zu bewegen. Gerade die telefonische – wenn gewünscht auch anonyme - Beratung stellt hier ein besonders niedrigschwelliges Hilfsangebot dar.
In letzter Zeit stand die UPD in der Kritik, unter anderem wurden Zweifel an der Neutralität und Qualität der Beratung laut. Sehen Sie Handlungsbedarf?
Meine Wahrnehmung ist, dass die Kritik oft unsachlich war. Sie müssen sich vor Augen führen, dass die Arbeit der UPD vom GKV-Spitzenverband sowie von einem Beirat eng begleitet und außerdem kontinuierlich wissenschaftlich evaluiert und auditiert wird.
Konkrete Aufgabe der Evaluation ist es zum Beispiel zu prüfen, ob das Leistungsangebot der UPD die Ziele der unabhängigen Patientenberatung erreicht. Im aktuellen Zwischenbericht zur Evaluation wird der UPD eine neutrale und unabhängige Beratung bescheinigt. Zudem stellt der Bericht eine hohe Akzeptanz und Nutzerzufriedenheit mit dem Angebot der UPD fest: Im Rahmen einer Nutzerbefragung gaben über 90 Prozent der Ratsuchenden an, dass die Beratung ihnen bei der Klärung ihres Anliegens weitergeholfen habe. Nahezu alle Befragten würden die UPD weiterempfehlen (99 Prozent). Das ist aus meiner Sicht ein insgesamt positives Zwischenergebnis der bisherigen Arbeit der UPD. An der Verbesserung ihres Beratungsangebotes muss die UPD konsequent weiter arbeiten, denn der Zwischenbericht weist auch auf Bereiche mit Verbesserungspotenzialen hin. Die UPD hat bereits ein Konzept für eine umfassende Qualitätsoffensive auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind verschiedene Maßnahmen unter anderem zur weiteren Verbesserung der Beratungsqualität. Die UPD arbeitet zudem daran, ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit noch weiter zu verbessern. Der Bekanntheitsgrad der UPD ist essenziell. Denn nur diejenigen, die die Möglichkeit dieser Beratung kennen, werden sie auch im Bedarfsfall in Anspruch nehmen.
Seit einiger Zeit wird über die Regelung zur Organspende diskutiert. Der Deutsche Bundestag hat sich jetzt für die Entscheidungslösung ausgesprochen. Wie verhalten Sie sich dazu, ist die Ihrer Meinung nach im Sinne der Patientinnen und Patienten?
Als Patientenbeauftragte verhalte ich mich in dieser Frage neutral. Ich werde Ihnen aber gern als Mitglied des Deutschen Bundestages antworten. Die Enttäuschung, dass sich die Mehrheit der Abgeordneten gegen einen Paradigmenwechsel entschieden hat, ist vor allem bei betroffenen Patientinnen und Patienten sehr groß. Ich hoffe, dass sich die Befürchtung der meisten Experten, die Entscheidungslösung werde zu keiner wesentlichen Steigerung der Transplantationszahlen führen, nicht bewahrheitet. Selbstverständlich werde ich mich im Sinne der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Angehörigen weiterhin für die Organspende einsetzen. Ich werde die Entwicklung der Transplantationszahlen sehr genau im Blick behalten und gegebenenfalls erneut für einen Paradigmenwechsel werben.














 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit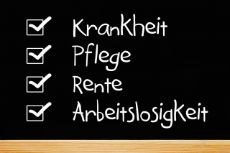 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


