Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) beschäftigt sich in seinem aktuellen Gutachten mit „Digitalisierung für Gesundheit“. Ratsvorsitzender Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach erläutert im Interview die Potenziale der Digitalisierung für die Versorgung, benennt Versäumnisse und plädiert dafür, den Datenschutz neu zu denken.

Wie digital ist das deutsche Gesundheitswesen aufgestellt?
Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach: Wenn man auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens blickt, wirkt Deutschland wie ein Entwicklungsland. Viele europäische Nachbarländer sind uns weit voraus, wir haben im Vergleich einen erheblichen Nachholbedarf. Uns fehlt auch ein durchdachtes, stringentes Konzept. Es gibt zwar inzwischen viele verschiedene Aktivitäten, aber keine verbindende Strategie mit einem klaren Ziel, auf das aus unterschiedlichen Richtungen zugearbeitet wird. Deshalb haben wir auch am Anfang unseres Gutachtens die Frage behandelt, wozu Digitalisierung überhaupt sinnvoll ist, und festgestellt, dass Digitalisierung natürlich kein Selbstzweck sein darf. Zweck der Digitalisierung ist die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, also der Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Und das wiederum dient einem höheren Zweck, nämlich dem Patientenwohl.
Hat die Pandemie die Digitalisierung beschleunigt?
Sicher, die Akzeptanz für digitale Prozesse ist deutlich gestiegen. Aber die Corona-Pandemie zeigt auch wie unter einem Brennglas die Stärken und Schwächen unseres Gesundheitssystems. Zum Beispiel wussten wir anfangs gar nicht, wie viele Intensivbetten es in Deutschland überhaupt gibt, wie viele belegt waren, wie viele Patienten beatmet wurden. Erst durch die Initiative einer Fachgesellschaft wurde unter dem Druck der Pandemie das digitale DIVIIntensivregister aufgebaut, womit wir jetzt zumindest einen minimalen Überblick haben und Patienten bei Bedarf auch gezielt verlegen können. Aber wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, wie alt die Patienten sind oder welche Vorerkrankungen sie haben. Ein weiteres Beispiel ist die anfängliche Übermittlung der Testergebnisse nur per Fax oder handschriftlich mit entsprechenden Verzögerungen und Lücken an das Robert Koch-Institut, obwohl bereits seit Jahren eine digitale Übertragung diskutiert wurde. Diese wurde dann zum Glück schrittweise eingeführt. Drittes Beispiel: die Kontaktnachverfolgung mit SORMAS. Dabei handelt es sich um ein in Deutschland entwickeltes System, das in Afrika seit Jahren problemlos läuft, aber bei uns nicht. Mittlerweile setzen es zunehmend mehr Gesundheitsämter ein. Ein letztes Beispiel: Die Corona-Warn-App wurde mit sehr hohem Aufwand entwickelt, bleibt aber im Ergebnis weit hinter den Möglichkeiten zurück. Nur etwa zwölf Prozent aller Testergebnisse gehen in die App und 41 Prozent der positiven Testergebnisse werden von den Nutzern nicht geteilt. Im Ergebnis ist es also leider eine Warn-App, die nicht zuverlässig warnt.
Warum ist Deutschland da so zögerlich?
Ein großes Problem in Deutschland ist eine im internationalen Vergleich eingeengte Debatte über Datenschutz. Wir haben hier auffällig restriktive Vorstellungen. Im Zweifel werden lieber gar keine Daten gesammelt, nicht gespeichert, nicht geteilt, bevor man irgendwelche Risiken eingeht. Dazu kommt, dass in Deutschland häufig die Betrachtung des Nutzens fehlt. Wir fokussieren uns sehr stark auf den potenziellen Missbrauch und sehen zu wenig den potenziellen Nutzen. Das ist in anderen Ländern anders, beispielsweise in Dänemark, Estland oder Israel, die alle besonders weit sind mit der Digitalisierung und davon profitieren. Dort haben die Menschen häufig generell andere Einstellungen, sie möchten zum Beispiel, dass ihre behandelnden Ärzte und Pflegekräfte bestmöglich über sie Bescheid wissen. Bei uns läuft die Debatte ganz anders. Wir wollen möglichst keine zentrale Speicherung der sensiblen Gesundheitsdaten und keine Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen.
Inwieweit beeinflusst der Datenschutz die Ausgestaltung der neuen elektronischen Patientenakte (ePA), die ja als Meilenstein der (digitalen) Versorgung gilt?
Das große Problem ist hier, dass der Versicherte mehrfach aktive Entscheidungen treffen muss, nicht nur zur Einrichtung der Akte, sondern auch bei Zugriffen eines jeden Leistungserbringers. Die Datenschützer möchten, dass das feingranular auf Dokumentenebene entschieden wird. Darüber hinaus gibt es noch ein zusätzliches Zustimmungsverfahren für die Nutzung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke. Letztlich sind mehrere, zum Teil zu wiederholende ausdrückliche Zustimmungsverfahren, sogenannte Opt-Ins, erforderlich. Wir sind davon überzeugt, dass das zu kompliziert ist und im Alltag nicht funktionieren wird.
Sind die Menschen überfordert mit den mehrfachen Zustimmungsverfahren?
Schauen Sie nach Frankreich: Dort wurde 2006 eine ePA mit ähnlichen Opt-In-Verfahren eingeführt, zehn Jahre später besaßen nur 1,5 Prozent der französischen Bevölkerung eine ePA. Daraufhin wurde die ePA strukturell verbessert, es gab eine Werbekampagne und finanzielle Anreize, und 2019 nutzten dann 20 Prozent der Franzosen die ePA. Jetzt wurde entschieden, dass jeder Franzose ab 2022 automatisch eine ePA bekommt und über sein Widerspruchsrecht informiert wird. Das ist die sogenannte Opt-Out-Option, so machen es von vornherein auch Dänemark und Estland. Wiederholte Opt-In-Verfahren sind faktisch sehr hohe Hürden. Es dürfte dazu führen, dass erstens weite Teile der deutschen Bevölkerung die ePA nicht nutzen und dass zweitens selbst aufgeklärte Versicherte ihre Akte nicht regelmäßig aktualisieren. Dann ist die Akte löchrig wie ein Schweizer Käse und die Ärzte werden zu Recht sagen, dass sie sich auf diese nicht aktuellen und unvollständigen Akten nicht verlassen können. Wir sollten aus unserer digitalen Rückständigkeit zumindest den Vorteil ziehen, dass wir aus den Fehlern anderer Länder lernen und diese nicht unnötig wiederholen.
Statt Opt-In also Opt-Out.
Ja. Wir empfehlen, dass jeder Bürger bei Geburt oder Zuzug automatisch eine ePA bekommt und eine zweifache Opt-Out-Möglichkeit hat. Erstens kann der Versicherte sagen, er will die ePA generell nicht haben. Zweitens kann er Inhalte verschatten und damit für andere unlesbar machen, anstatt sie – wie derzeit vorgesehen – unwiderruflich zu löschen. Eine Verschattung ist besser als eine Löschung, da viele Patienten nicht sicher einschätzen können, ob und für wen welche Daten in ihrer Akte wann relevant sind.
Sie wollen Daten auch automatisch der Forschung zur Verfügung stellen. Zunächst einmal: Warum wollen Sie so viele Daten sammeln?
Nehmen wir das Beispiel Onkologie. Wir wissen inzwischen, dass es mindestens 60 verschiedene Arten von Brustkrebs gibt, die unterschiedlich auf Therapien reagieren. Heute wird das komplette Genom eines Tumors analysiert und dadurch erhalten wir wichtige molekulare und genetische Informationen. Diese Daten brauchen wir, um sie miteinander vergleichen, Therapien entwickeln und individuelle Patienten optimal behandeln zu können. Genauso ist es letztlich im Interesse eines jeden einzelnen Patienten, wenn den Behandlern vollständige Daten, vom Medikationsplan über Diagnosen und Vorerkrankungen bis hin zu bisherigen Therapien, zur Verfügung stehen. Viele Erkrankungen sind komplexer, als wir bisher dachten, und können nur so optimal behandelt werden. Und dann gibt es Versorgungsbereiche, deren Relevanz auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich ist wie beispielsweise die Antibaby-Pille. Sie wird in Deutschland auf Privatrezept verordnet und somit nicht systematisch erfasst. Inzwischen wissen wir, dass junge Frauen, die in den letzten Jahrzehnten die Pille genommen haben, Thrombosen und schwere, zum Teil tödliche Embolien bekommen haben. Das wäre uns in Deutschland niemals aufgefallen. Wir kennen diesen Zusammenhang nur, weil in Skandinavien Surveillance-Systeme, Register und eine Verknüpfung mit den Daten der ePA existieren. Wir schmarotzen hier also letztlich von Erkenntnissen aus elektronischen Patientenakten aus anderen Ländern.
Wie wollen Sie an die Daten kommen, was muss getan werden?
Wir stehen auf dem Standpunkt, dass es in einer Solidargemeinschaft wie in der Gemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten sogar geboten ist, dass Gesundheitsdaten pseudonymisiert oder anonymisiert für allgemeinwohldienliche Forschung zum Nutzen aller geteilt werden. Wir würden es daher zustimmungsfrei ermöglichen, wie es übrigens auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Artikel 9 Absatz 2 ausdrücklich vorsieht, die ja für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt. Außerdem können die Mitgliedstaaten durch nationales Recht festlegen, wie sie Gesundheitsdaten nutzen wollen. Die DSGVO ist wesentlich flexibler und klarer, als es in Deutschland den Eindruck macht. Allerdings vermuten wir, dass sich die zustimmungsfreie Bereitstellung in Deutschland derzeit noch nicht durchsetzen wird, daher ist unser Alternativvorschlag die Nutzung mit Widerspruchsrecht, also auch wieder mit einem Opt-Out. Die Versorgungsdaten werden dann in ein Forschungsdatenzentrum übertragen, dort unabhängig treuhänderisch verwaltet und ein Komitee entscheidet nach strengen, auch ethischen und datenschutzrechtlichen Spielregeln über die Nutzung. Ein Prinzip, das weltweit in vielen Industrienationen genauso praktiziert wird.
Aber lauern da nicht auch Gefahren wie etwa Missbrauch oder Datenklau?
Ganz wichtig an dieser Stelle: Wir sagen nicht, dass wir weniger Datenschutz wollen. Wir wollen nur nicht den Datenschutz alter Schule. Der Datenschutz alter Schule wurde nach dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 1983 entwickelt und zielt auf Datensparsamkeit bzw. Datenminimierung sowie auf enge Zweckbindung. Aber da stoßen wir heute ganz schnell an Grenzen. Gerade bei Big Data und Künstlicher Intelligenz ist es schlicht nicht möglich, und es schadet inzwischen mehr, als dass es nutzt. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, der in den 80er Jahren richtig war, aber in einer digital-vernetzten Welt von heute nicht mehr zielführend ist, dann schöpfen wir die positiven Potenziale nicht aus. Deswegen wollen wir den Datenschutz weiterentwickeln und zu einem neuen Konzept kommen.
Wie soll das Konzept aussehen?
Es werden zwei Punkte betont: Zum einen wollen wir eine verstärkte Investition in eine höhere technische Datensicherheit. Zum Beispiel sollte bei jedem Zugriff auf die ePA ein unlöschbarer Zeitstempel erfolgen, der in der Akte dokumentiert wird. Volle Transparenz also. Der zweite Punkt sind verschärfte Verbotsnormen und Sanktionsmöglichkeiten. Wenn eine Person auf die Akte zugreift, die nicht dazu berechtigt ist, sollen Übergriffe zukünftig schärfer und transparent bestraft werden. Wir wollen außerdem die Verhältnisse vom Kopf auf die Füße stellen und ein Anrecht der Patienten auf optimale Verarbeitung der vorhandenen Gesundheitsdaten verankern.
Wie zuversichtlich sind Sie?
Um das zu ermöglichen und sowohl die Bevölkerung als auch die Politik zu überzeugen, brauchen wir unbedingt eine öffentliche Debatte. Deutschland kann sich hier nicht länger zurücklehnen. Im Gegenteil, in der nächsten Legislaturperiode sollte der Bundestag ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz beschließen, das den Umgang mit Gesundheitsdaten klärt. Das ist in anderen Ländern bereits geschehen und in Deutschland überfällig. Genauso klar ist, dass ein europäischer Datenraum kommen wird, und auch daran sollte sich Deutschland aktiv und konstruktiv beteiligen.
Inwieweit sind Leistungserbringer und Versicherte interessiert daran, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben?
Die meisten Leistungserbringer stehen der Digitalisierung positiv gegenüber. Aber wenn ich gesundheitliche Versorgung digital abbilde, wird vielleicht auch deutlich, wo zu viel gemacht, ineffizient gearbeitet oder schlechte Qualität geliefert wird. Diese Transparenz ist von einigen nicht gewollt. Auf der anderen Seite aber ist klar, dass wenn die Digitalisierung unser Leben, unsere Arbeit, unsere Gesundheit leichter bzw. besser macht, dann setzt sie sich durch. Die Motivation zur Anwendung der digitalen Möglichkeiten muss über den Nutzen und positive Beispiele motiviert werden, nicht über Zwang. Man muss zu der Überzeugung gelangen und auch konkret erleben, dass Digitalisierung mehr nutzt als Risiken birgt.
Kann Digitalisierung auch schaden?
Ja, man muss zum Beispiel aufpassen, dass ineffiziente Strukturen durch die Digitalisierung nicht weiter verfestigt werden. Die Digitalisierung ist nicht die einzige Reform, die wir im Gesundheitswesen brauchen. Dringend notwendig sind eine Krankenhausstrukturreform und eine umfassende Notfallreform. Wenn jetzt einfach nur Geld für Digitalisierung mit der Gießkanne verteilt wird, ohne gleichzeitig strukturelle Reformen in Angriff zu nehmen, besteht zum Beispiel die Gefahr, dass nicht bedarfsnotwendige Krankenhausstandorte in Städten zementiert werden, obwohl eine Konzentration und Schwerpunktbildung zielführender wäre. Digitalisierung darf nicht bedarfsnotwendige Strukturen nicht unnötig am Leben erhalten und sie darf ebenso wenig einen notwendigen Strukturwandel verzögern. Ich habe die Hoffnung, dass durch den 2022 enorm zunehmenden Kostendruck manche überfällige Strukturentscheidung endlich auch getroffen wird, flankiert durch eine entsprechende Digitalisierung mitsamt einer zielführenden Debatte um einen neuen Datenschutz.
Und welchen Appell richten Sie an die Patientinnen und Patienten, gehen diese den von Ihnen skizzierten Weg der Digitalisierung mit?
Patientinnen und Patienten können letztlich nur über den konkret erlebten Nutzen vom Sinn der Digitalisierung überzeugt werden. Wenn sie spüren, dass digitale Anwendungen wie das elektronische Rezept oder die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ihr Leben einfacher und besser machen und eine elektronische Patientenakte mit digitalem Medikationsplan oder Impfausweis eine bessere Versorgung ermöglichen, sollte die Digitalisierung des Gesundheitswesens auch in Deutschland gelingen. Eine adressatengerechte Kommunikation und eine Steigerung der in Teilen der Bevölkerung allzu oft kaum vorhandenen digitalen Gesundheitskompetenz ist dabei eine gemeinsame Aufgabe mit hoher Priorität.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 3. Ausgabe 2021
-
 Interview mit dem vdek-Verbandsvorsitzenden Uwe Klemens
Interview mit dem vdek-Verbandsvorsitzenden Uwe Klemens„Der Selbstverwaltung mehr Entscheidungskompetenz zutrauen“














 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit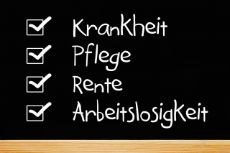 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


