Seit Mitte Januar 2022 ist Stefan Schwartze Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten. Im Interview spricht er unter anderem über seine neue Rolle in der Gesundheitspolitik sowie den Handlungsbedarf mit Blick auf Patientenrechte und Patientensicherheit.

Seit 2009 sind Sie Bundestagsabgeordneter, seit zwölf Jahren Mitglied des Petitionsausschusses. Woher rührt nun Ihr Interesse an Gesundheitspolitik und inwieweit hilft Ihnen diese Erfahrung in Ihrem neuen Amt als Patientenbeauftragter?
Stefan Schwartze: Die überwiegende Mehrheit der Petitionen stammt aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Man kann also sagen, dass meine zwölf Jahre im Petitionsausschuss eine solide Vorbereitung auf mein jetziges Amt darstellen. Der direkte Kontakt mit den Anliegen der Patientinnen und Patienten hat mich ihre persönlichen Schicksale und die Wirkung unserer Beschlüsse konkret miterleben lassen. Diese Arbeit war für mich eine wichtige Erfahrung. Mit dieser Perspektive gehe ich auch meine neue Aufgabe an, um die Interessen der Patientinnen und Patienten gut zu vertreten.
Wie bewerten Sie Ihren Einfluss als Patientenbeauftragter, inwiefern können Sie Gesundheitspolitik mitgestalten?
Nach den ersten Monaten als Patientenbeauftragter bin ich davon überzeugt, dass das Amt mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet, als es vielen bekannt ist und möglicherweise bisher genutzt wurde. Die Aufgaben und die Befugnisse sind – im Gegensatz zu vielen anderen Beauftragten – gesetzlich geregelt. So müssen mich zur Wahrnehmung dieser Aufgabe die Bundesministerien bei allen Gesetzesvorhaben mit Patientenrelevanz beteiligen. Bundesbehörden und öffentliche Stellen im Bereich des Bundes sind gesetzlich verpflichtet, mich bei der Erfüllung meiner Aufgabe zu unterstützen. Das unterstreicht die Bedeutung des Amtes und auch die Verantwortung dieser Aufgabe.
Als Patientenbeauftragter sind Sie dem Bundesgesundheitsministerium zugeordnet. Es wurde diskutiert, das Amt direkt dem Bundestag zu unterstellen. Was halten Sie davon?
Die Idee hat einen gewissen Reiz. Dennoch will ich zunächst versuchen, die Möglichkeiten, die das Amt bietet, intensiv zu nutzen und mich als unabhängiges – falls erforderlich auch kritisches – Sprachrohr für die Patienteninteressen und die Stärkung ihrer Rechte einzusetzen.
Jetzt zu den Inhalten Ihrer Arbeit. Was bewegt Ihrer Erfahrung nach die Patientinnen und Patienten, welche Probleme wurden und werden an Sie herangetragen? Erreichen Sie auch gute Nachrichten?
Es gibt eine Vielzahl von Themen, die mein Team und mich erreichen. Seit Beginn der Pandemie häufen sich Anfragen rund um das Thema Corona, Impfungen, Masken und neuerdings auch zu den langfristigen Folgen einer Covid-19-Infektion. Aber auch Beschwerden über Ablehnungen von Leistungen oder Behandlungskosten durch die Krankenkassen und über Krankenhausbehandlungen kommen regelmäßig vor. Zudem wenden sich Patientinnen und Patienten immer wieder an mich, um sich über ihre Rechte, aber auch die Pflichten der Leistungserbringer zu informieren. Gute Nachrichten sind selten. Das ist aber auch verständlich: Die Menschen kontaktieren mich ja gerade deshalb, weil sie konkrete Probleme und Sorgen haben.
Wo wollen Sie während Ihrer Amtszeit Schwerpunkte setzen, wo sehen Sie besonderen Handlungsbedarf? Und welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Mein Ziel ist es, die Perspektive der Patientinnen und Patienten mit einer starken Stimme hörbar zu machen – insbesondere derjenigen, die in unserem Gesundheitssystem durchs Raster fallen oder die nicht beziehungsweise nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst einzutreten. Ganz konkret setze ich mich dafür ein, die Patientensicherheit weiter zu erhöhen, die Patientenrechte zu stärken und die Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern.
Stichwort Behandlungsfehler: Die Unabhängige Patientenberatung (UPD) hat im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge in rund 5.000 Fällen zu vermuteten Behandlungsfehlern beraten. Wie schätzen Sie diese Zahl ein? Und was kann man tun, um Behandlungsfehler zu vermeiden?
Fehler lassen sich leider nie vollständig vermeiden. Ich halte mir aber immer vor Augen, dass hinter jedem Behandlungsfehler ein Mensch mit einer Geschichte, vielleicht sogar einem dramatischen Schicksal steht. Wir müssen daher alles dafür tun, um die Patientensicherheit in der Versorgung bestmöglich zu gewährleisten. Dazu gehört eine offene und ehrliche Fehlervermeidungs- und auch Fehlerkommunikationskultur, um Behandlungsfehler transparent zu machen, aus ihnen zu lernen und sie in Zukunft verhindern zu können.
Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einem Härtefallfonds. Was genau ist damit gemeint? Und welche Rolle spielt die Beweislast?
Die hohen rechtlichen Anforderungen an die Verteilung der Beweislast machen es Betroffenen aktuell schwer nachzuweisen, dass ein Behandlungsfehler die Ursache des Schadens ist. Die Absenkung des Beweismaßes und auch ein Härtefallfonds könnten dazu beitragen, die Rechte der Patientinnen und Patienten bei Behandlungsfehlern nachhaltig zu stärken. Viele Details des Härtefallfonds sind noch zu klären. Ich fände es aber sinnvoll, wenn der Fonds Betroffenen schnelle finanzielle Hilfe für erforderliche Ausgaben leisten würde. Im Falle einer Verurteilung sollte dann der Verursacher des Schadens die Hilfe an den Fonds zurückzahlen müssen und nicht die Patientin oder der Patient.
Noch immer gibt es eine hohe Dunkelziffer bei Behandlungsfehlern. Ist die Zeit reif für ein nationales Register für Behandlungsfehler? Wenn ja, von wem beziehungsweise unter welcher Trägerschaft könnte solch ein Register umgesetzt werden? Und wie steht es insgesamt um die Transparenz?
Ich plädiere zur Erhöhung der Patientensicherheit in einem ersten Schritt für den Aufbau eines nationalen Registers zur anonymen Erfassung von besonders schwerwiegenden, aber vermeidbaren Fehlern, den sogenannten Never Events. Die Daten eines solchen Meldesystems könnten die Grundlage bilden, um Fehler systematisch zu erfassen, zu analysieren und letztendlich aus den Ergebnissen passende Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Vorschläge zur Umsetzung hat beispielsweise das Aktionsbündnis Patientensicherheit bereits vorgelegt.
Der Koalitionsvertrag sieht darüber hinaus vor, die UPD in eine dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur zu überführen. Wie stellen Sie sich eine Weiterentwicklung vor? Welche Bedeutung schreiben Sie der UPD zu?
Die UPD leistet durch ihr qualitätsgesichertes Informations- und Beratungsangebot einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Gesundheitskompetenz der Ratsuchenden. Dieses Beratungsangebot durch eine Reform noch bekannter, noch besser zu machen und langfristig zu sichern, ist mir ein wichtiges Anliegen. Zentral ist dabei für mich, dass die Strukturen verstetigt werden und die Beratung unabhängig und neutral erfolgt. Dazu erscheint mir aktuell eine Stiftungsstruktur als am besten geeignet. Allerdings kommen auch andere Lösungen in Betracht, die derzeit intensiv diskutiert werden.
Stichwort Digitalisierung: Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Zusammenhang mit den Patientenrechten? Welche neuen Fragestellungen ergeben sich aus der immer stärker zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens?
Die Patientenrechte müssen auch im digitalen Zeitalter Bestand haben. Wir brauchen daher einen Rahmen, der eine praktikable und sichere Datennutzung ermöglicht und gleichzeitig die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer in der digitalen Welt schützt. Dazu gehören beispielsweise eine möglichst frühzeitige Einbindung von Patientinnen und Patienten in den Digitalisierungsprozess, ein Anspruch auf laienverständliche Informationen über Vor- und Nachteile digitaler Lösungen und die Sicherstellung der persönlichen Entscheidungsfreiheit darüber, ob eine digitale Anwendung genutzt wird oder nicht.
Ein wichtiges Thema ist dabei das Thema Datenschutz. Auf der anderen Seite sind Daten in der Gesundheitsforschung und aktuell in der Pandemiebekämpfung enorm wichtig. Wie lässt sich hier abwägen? Und wie lassen sich ethische Gesichtspunkte gerade unter datenschutzrechtlichen Dingen berücksichtigen?
Die Erfahrungen in der Pandemie haben gezeigt, welchen Mehrwert ein digital vernetztes Gesundheitssystem haben kann. Digitale Technologien werden dann akzeptiert, wenn der Patientennutzen ganz konkret erlebbar ist und die Versorgungsrealität für alle Beteiligten sicherer, einfacher und komfortabler wird. Datenschutz, Datensicherheit und Datennutzung in diesem Sinne richtig auszubalancieren, ist die große Herausforderung. Ich bin davon überzeugt, dass die im Koalitionsvertrag verabredeten Maßnahmen, ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz zu verankern sowie bei der Digitalisierungsstrategie auf die Nutzerperspektive zu fokussieren, in die richtige Richtung gehen, um diese Balance zukünftig zu erreichen.
Stichwort IGeL: Eine Forsa-Umfrage des vdek hat kürzlich offengelegt, dass 25 Prozent der befragten Patientinnen und Patienten bereits beim Betreten der Praxis aufgefordert wurden, eine individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) in Anspruch zu nehmen. Bei sechs Prozent wurde die Behandlung sogar davon abhängig gemacht. Wie bewerten Sie das?
Es ist nicht akzeptabel, dass Patientinnen und Patienten zu IGeL gedrängt werden und ausdrücklich unzulässig, eine medizinisch notwendige Behandlung oder Untersuchung davon abhängig zu machen, dass IGeL in Anspruch genommen werden. Ich empfehle allen, die sich bei IGeL unsicher sind, sich Zeit zu nehmen und sich gut zu informieren und beraten zu lassen. Wer das Gefühl hat, dass sich die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt nicht angemessen verhalten hat, sollte dies der für das Bundesland zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung melden, die den Fall dann prüft.
Ein weiteres Problem: Privatpatientinnen und -patienten erhalten vor allem bei Fachärztinnen und Fachärzten im Durchschnitt schneller einen Termin als Kassenpatientinnen und patienten. Was kann dagegen getan werden?
Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz wurden bereits im Jahr 2020 zahlreiche Maßnahmen beschlossen, damit gesetzlich Versicherte schneller Arzttermine erhalten. Dazu gehört eine bessere Vergütung der Ärztinnen und Ärzte für die Behandlung neuer Patientinnen und Patienten, aber auch die Erhöhung des Mindestsprechstundenangebots. Mein Eindruck ist, dass diese Maßnahmen langsam wirken. Ich werde diese Thematik aber weiter beobachten. Denn klar ist: Übermäßig lange Wartezeiten für gesetzlich im Vergleich zu privat versicherten Patientinnen und Patientinnen sind nicht hinnehmbar.
Werfen wir noch einen Blick auf Corona. Operationen mussten verschoben werden, Versicherte haben Vorsorgeuntersuchungen weniger wahrgenommen – sehen sie hier besonderen Handlungsbedarf in Sachen Patientensicherheit?
Die Pandemie hat gezeigt, dass die zielgruppengerechte und laienverständliche Aufklärung viel besser werden muss. Das gilt zum einen mit Blick auf die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe, um eine möglichst hohe Impfbereitschaft zu erreichen. Das ist das wirksamste Mittel, um eine Überlastung des Gesundheitssystems und die Verschiebung von Operationen zu verhindern. Darüber hinaus müssen die Menschen aber auch immer wieder dafür sensibilisiert werden, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und vor allem im Notfall medizinische Hilfe zu suchen.
Die Politik wirbt fürs Impfen. Es gibt allerdings Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und welche, die sich nicht impfen lassen können. Wie verhalten Sie sich als Patientenbeauftragter dazu, der alle (potenziellen) Patientinnen und Patienten vertritt?
Wichtig ist mir bei dieser Frage, dass Patientinnen und Patienten, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder bei denen keine ausreichende Impfantwort erzielt werden kann, zusätzliche Schutzmaßnahmen angeboten bekommen. Wie beispielsweise der Anspruch auf bestimmte Arzneimittel zum präventiven Einsatz gegen Covid-19. Auch wenn ich es für einen selbstverständlichen Akt der Solidarität halte, sich impfen zu lassen, wenn ich es kann, um diejenigen, die es nicht können, zu schützen, vertrete ich als Patientenbeauftragter die Patienteninteressen selbstverständlich unabhängig vom Impfstatus.
Zum Schluss noch ein Perspektivenwechsel: Was erwarten Sie selbst als Patient vom Gesundheitswesen, was wünschen Sie sich und wo sehen Sie sich als Patient selbst in der Verantwortung?
Ich wünsche mir als Patient, dass ich nicht bevormundet werde, sondern mit mir ernsthaft auf Augenhöhe kommuniziert wird. Zudem benötige ich gut verständliche und verlässliche Gesundheitsinformationen, damit ich selbstbestimmt und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen kann. Patientinnen und Patienten möchte ich insgesamt ermutigen, sich intensiver mit gesundheitlichen Fragen und ihren Rechten auseinanderzusetzen und auf ihre Rechte notfalls auch zu bestehen.


















 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit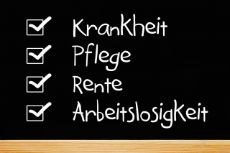 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


