Wenn ein Unternehmen eine Unternehmens- oder Organisationsreform beabsichtigt, so wird diese in der Regel nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, die Mitarbeiterschaft bei dem Vorhaben mitzunehmen. Diese Erkenntnis kann man auch auf die Krankenhausreform übertragen. Wenn es dem Bund nicht gelingt, die Länder mitzunehmen und für das Vorhaben zu motivieren, ist die Krankenhausreform von vornherein zum Scheitern verurteilt, spätestens bei ihrer Umsetzung.

Vor zwei Jahren hat der Bundesgesundheitsminister eine Regierungskommission einberufen, die den Weg für eine Krankenhausreform ebnen sollte. Insgesamt zehn Empfehlungen und Stellungnahmen gab die Regierungskommission mittlerweile ab. Dem folgten zahlreiche Arbeitsentwürfe und die Vorlage eines oftmals verschobenen Referenten- und Kabinettsentwurfs eines Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG). Wichtige Teile wurden ausgeklammert und in das Krankenhaustransparenzgesetz verlagert. Das Gesetz soll von den Ländern zustimmungsfrei ausgestaltet werden. Wichtige Teile wie die inhaltliche Ausgestaltung der Leistungsgruppen oder der Festlegung von Mindestvorhaltezahlen sollen in zustimmungspflichtigen Rechtsverordnungen geregelt werden. Insofern kann man getrost von einer Salamitaktik und der vielzitierten Katze im Sack sprechen, wenn es um die Krankenhausreform geht.
Der Bundesgesundheitsminister spricht bei der Krankenhausreform mehrfach von einer Revolution, also einem abrupten grundlegenden Systemwandel. Entökonomisierung, Qualitätssicherung und Entbürokratisierung sind die Ziele, die er mit der Reform erreichen möchte. Der gemeinsame Nenner mit den Ländern und den Krankenhäusern sowie zunehmend auch mit den Krankenkassen scheint schmaler zu werden. Die Zielvorstellungen scheinen auseinanderzudriften: ein Umstand, der bei der Umsetzung der Reform zum Problem werden kann.
Reformnotwendigkeit
Seit der Einführung der diagnoseabhängigen Fallpauschalen (DRG) gab es keine nennenswerte Reform im Krankenhaussektor mehr. Allerdings sind in den letzten Jahren viele Veränderungen, die direkt und indirekt von der DRG-Einführung oder von exogenen Faktoren abhängen, eingetreten. Die Krankenhäuser reduzierten ihre Kosten, indem sie insbesondere Pflegepersonal eingespart sowie die Verweildauer reduziert haben und gleichzeitig die Fallzahl steigern konnten. Die Ausgaben der Krankenkassen konnten hiervon nicht entlastet werden, im Gegenteil. Die Zahl der Krankenhäuser hat sich erheblich verringert. Dies ging insbesondere auf Fusionen zurück, denn die Zahl der Standorte ist nahezu konstant geblieben. Die Länder merkten schnell, dass, wenn die Krankenhäuser Gewinne bei den Betriebskosten realisieren, sie ihre Investitionsmittel reduzieren konnten. Anstatt eine aktive Planung der Krankenversorgung voranzutreiben, dokumentierten sie die Veränderungen des Krankenhausmarktes in ihren Krankenhausplänen. Die gewinnorientierten Krankenhausträger richteten ihr Leistungsportfolio an monetären und nicht an Versorgungsgesichtspunkten aus. Ländliche strukturschwache Gebiete neigen daher heute zur Unterversorgung und die prosperierenden Ballungsgebiete zur Überversorgung. Hinzu kommt in den ländlichen Regionen eine Überalterung und Schrumpfung der Bevölkerung und in den Ballungsgebieten ein aufgrund der Überversorgung ausgeprägter Fachkräftemangel. All dies erfordert Maßnahmen einer Krankenhausreform. Die Krankenhausvertreter fordern zur Lösung dieser Probleme wie schon seit Jahrzenten mehr Geld. Dies wird von den Ländern unterstützt. Sie sehen darüber hinaus keine Notwendigkeit, ihr bisheriges passives Handeln zu ändern, geschweige denn ihren Investitionsverpflichtungen auch nur ansatzweise nachzukommen. Und die Krankenkassen wollen zukunftsfähige effiziente Strukturen, die auch in Zukunft noch finanzierbar sind und den Beitragszahler finanziell nicht überfordern. Der Bund steht also vor dem Dilemma, dass die finanziellen und personellen Ressourcen nicht ausreichen, um alle Krankenhäuser am Markt zu halten. Dass die ökonomisch gewachsenen Krankenhausstrukturen zwar die teuersten, nicht aber unbedingt die im internationalen Vergleich qualitativ hochwertigsten sind, verstärkt den Reformbedarf; ebenso, dass regionale Versorgungsunterschiede und insbesondere der nach der Pandemie eingetretene Fallzahlrückgang unterschiedliche Ursachen haben. Während in den Ballungsgebieten auf der Angebotsseite der Fachkräftemangel überwiegt, ist es in den ländlichen Regionen auf der Nachfrageseite der Bevölkerungsrückgang.
Strukturreform
Die strukturellen Veränderungen der Krankenhauslandschaft sollen im Rahmen der Krankenhausreform über die Vorhaltekostenfinanzierung erreicht werden. Diese hat eigentlich primär das Ziel, leistungsunabhängig die Bereitstellung eines Betriebes finanziell zu sichern. Die konkreten Überlegungen hierzu sind seitens des Gesetzgebers zu einer Zeit gereift, als die Fallzahlen der Krankenhäuser stark zurückgegangen waren und die Krankenhäuser ihre fixen Kosten mit den erzielten Erlösen nicht ausreichend decken konnten. Anstatt die Mehr- oder Mindererlösausgleiche anzupassen, geht das KHVVG einen neuartigen Weg. Die Finanzierung der Vorhaltekosten bezieht sich nicht auf ein ganzes Krankenhaus, sondern auf Teilbereiche des Leistungsgeschehens, sogenannte Leistungsgruppen. Leistungsgruppen sind vereinfacht ausgedrückt Unterbereiche von Fachabteilungen. Die Leistungsgruppen sind an Qualitätsanforderungen gebunden. Erfüllt ein Krankenhaus diese nicht, erhält es grundsätzlich keine Vorhaltekostenvergütung, es sei denn, das Land macht von seiner Kompetenz der Anwendung von Ausnahmeregelungen Gebrauch. Ist dies nicht der Fall, erhöht sich der Anteil der Vorhaltekostenvergütung derjenigen Krankenhäuser, die legitimiert werden, die Leistungsgruppe in einem Land zu erbringen. Die Vorhaltekostenfinanzierung verliert damit ihre Funktion der Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung und bekommt eine Selektionsfunktion. In den Ballungsgebieten, wo Überversorgung und akuter Fachkräftemangel herrschen, ist diese Selektion sehr begrüßenswert. In den ländlichen Regionen führt diese neue Finanzierungssystematik zur weiteren Unterversorgung. Gerade für die stationäre Grundversorgung in den ländlichen strukturschwachen Gebieten ist sie ungeeignet und wird zurecht von den Ländern kritisiert. Weshalb gerade die sogenannten Level 1i-Kliniken, die ausschließlich in den ländlichen Gebieten sinnvoll sind, keine explizite Vorhaltekostenvergütung erhalten sollen, bleibt unklar. Die Probleme in der Versorgungssituation der ländlichen und urbanen Gebiete haben unterschiedliche Ursachen; folglich muss eine einheitliche Lösung ins Leere laufen. Die schon im Koalitionsvertrag vorgesehene regionale Differenzierung fehlt in den Regelungsinhalten eines KHVVG.
Ob es in den Ballungsgebieten zu einer Selektion von Krankenhäusern bei der Vergabe der Leistungsgruppen kommt, hängt von der Ausgestaltung der qualitativen Anforderungen ab. Zunächst wurde diese aus der Landesplanung aus Nordrhein-Westfalen in die Bundesgesetzgebung übertragen. Ausreichende finale Umsetzungserfahrungen liegen aber vermutlich erst zum Ende dieses Jahres vor. Die Pflege und Weiterentwicklung sollen in einer zustimmungspflichtigen Rechtsverordnung geregelt werden. Es ist zu erwarten, dass die Länder ihre jetzt schon eingeräumten Ausnahmeregelungen stärken und weiche Qualitätsanforderungen verlangen werden. Das Ausmaß der erhofften Selektion in der Leistungserbringung der einzelnen Leistungsgruppen kann daher jetzt schwer vorhergesagt werden. Die vom Bundesminister angekündigte Auswirkungsanalyse kann dies nicht ändern.
Eine weitere Stellschraube im Selektionsprozess sollen Mindestvorhaltezahlen einzelner Leistungsgruppen sein. Krankenhäuser eines unteren Perzentils in der Erbringung von Fallzahlen von Leistungsgruppen sollen von der Vorhaltekostenvergütung und damit von der Abrechnungsfähigkeit der betroffenen Leistungen ausgeschlossen werden. Die Ausgestaltung beziehungsweise Festlegung der Regelungen soll ebenfalls in einer zustimmungspflichtigen Rechtsverordnung geregelt werden. Auch hier gilt das Gleiche wie zu den oben ausgeführten Leistungsgruppen. Die Interessen zwischen Bund und Ländern dürften sich diametral verhalten; der Ausgang ist ungewiss.
Finanzierungsreform
Im Gegensatz zum ungewissen Ausgang der Strukturreform stehen die finanziellen Folgen der Reform schon heute fest: Es wird zu enormen Mehrausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) kommen. Allein für den Transformationsfonds werden ab 2026 jährlich 2,5 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds entnommen. Es ist zudem zu befürchten, dass der Transformationsfonds während seiner zehnjährigen Laufzeit schnell zweckentfremdet und für andere Investitionsprojekte aus dem Zuständigkeitsbereich der Länder verwendet wird. Gleichzeitig soll den Kassen ab 2027 die Möglichkeit der Einzelfallprüfung genommen werden, was den Verlust von 1 Milliarde Euro mit sich bringt, die derzeit aufgrund der Einzelfallprüfungen jährlich an die GKV zurückfließt. Die Stichprobenprüfung, die stattdessen eingeführt werden soll, kann die Einzelfallprüfung kaum gleichwertig ersetzen. Um eine effektive Anreizwirkung für eine korrekte Abrechnung zu erhalten, wären eine realistische Hochrechnung der Prüfergebnisse und harte Sanktionen bei Falschabrechnungen notwendig. Beides ist nicht zu erwarten, da das Verfahren mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vereinbart werden muss, die naturgemäß kein Interesse an einer Sanktionierung der Krankenhäuser besitzt. Die Einführung der Stichprobenprüfung verfolgt das Ziel der Entbürokratisierung. Sie führt jedoch zu Mehrausgaben und Fehlversorgung; insbesondere, weil durch fehlende Prüfmöglichkeiten auch die zwingend erforderliche Ambulantisierung untergraben wird.
Im Rahmen der Reform sind weitere Regelungen vorgesehen, die zu Ausgabensteigerungen führen, ohne die Versorgung der Patienten zu verbessern. Solch teure Vorhaben sind die vollständige Refinanzierung der Tarifsteigerungen und die Anwendung des vollen Orientierungswerts als Obergrenze für die Entwicklung der Landesbasisfallwerte. Obwohl die Personalkosten der Krankenhäuser auch heute schon auskömmlich finanziert werden, werden die Krankenhausbudgets mit diesen Regelungen gleich doppelt erhöht. Wenn man den aktuell gültigen Orientierungswert und die aktuell gültigen Landesbasisfallwerte zugrunde legt, würden die Regelungen zu jährlichen Mehrausgaben von 1,5 Milliarden Euro führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Tarifsteigerungen zukünftig einfach durchgereicht und die Kassen somit noch stärker belastet werden.
Die Einführung der Vorhaltefinanzierung soll hingegen ausgabenneutral erfolgen. Jedoch sind für bestimmte Fachrichtungen neben den Vorhaltebudgets jährliche Zuschläge in Höhe von insgesamt fast 800 Millionen Euro ab 2027 vorgesehen, die im Gesetz nicht näher begründet werden. Ein Nutzen für die Patienten ist daher auch hier zu bezweifeln. Wenn man die finanzielle Wirkung der zuvor beschriebenen Regelungen und die Zuschläge zusammenrechnet, führt die Reform ab 2027 zu jährlichen Mehrausgaben von etwa 5,8 Milliarden Euro.
Ausblick
Wenngleich die Krankenhausreform noch nicht das parlamentarische Verfahren durchlaufen hat, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Länder letztendlich bei der Umsetzung dem Bund die Unterstützung verweigern werden. Die zusätzlichen finanziellen Mittel, die erneut mit der Gießkanne verteilt werden, verstärken die regionalen und strukturellen Ungleichgewichte, anstatt sie zu beheben. Die fehlende regionale Differenzierung bei den Regelungsinhalten wird diese Fehlentwicklungen noch verstärken. Es droht eine reine Finanzierungsreform für obsolete Krankenhausstrukturen.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (3. Ausgabe 2024)
-
 Interview mit Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung
Interview mit Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung„Scheitern ist keine Option“











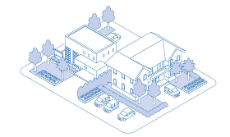


 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit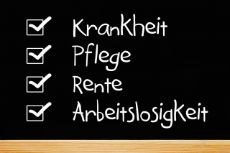 Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


